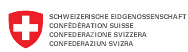Demokratische Republik Kongo - Länderinformationsblätter
| Publisher | Switzerland: State Secretariat for Migration (SEM) |
| Publication Date | 1 July 1997 |
| Cite as | Switzerland: State Secretariat for Migration (SEM), Demokratische Republik Kongo - Länderinformationsblätter, 1 July 1997, available at: https://www.refworld.org/docid/466fd72d2.html [accessed 3 November 2019] |
| Disclaimer | This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States. |
1. Verfassung
1.1. Staatsname
Demokratische Republik KongoStaatssymbol und Staatswappen
Das Staatssymbol der 'Demokratischen Republik Kongo' war uns bei der Redaktion des vorliegenden Informationsblattes nicht bekannt. Wappen: Marineblauer Hintergrund - in der Mitte grosser gelber Stern - links sechs kleine gelbe Sterne übereinander1.3. Staatsform
Am 28. Mai 1997 erliess die AFDL das 'Verfassungsdekret Nr. 003 vom 27. Mai 1997 über die Organisation und die Ausübung der Staatsgewalt in der Demokratischen Republik Kongo' (Décret constitutionnel No 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo). Damit wurden sämtliche früheren Verfassungsbestimmungen aufgehoben. Dieser Erlass ist dazu bestimmt, bis zur Annahme einer 'Übergangsverfassung durch die verfassunggebende Versammlung' in Kraft zu bleiben und überträgt die Staatsgewalt im wesentlichen dem Präsidenten der Republik. Dieser ist ebenfalls Regierungschef und Oberkommandierender der Armee; ferner übt er 'die gesetzgebende Gewalt durch ein im Ministerrat verabschiedetes Gesetzesdekret' aus. Insoweit "ernennt" der Staatschef die Botschafter und die ausserordentlichen Gesandten, die Gouverneure und Vizegouverneure der Provinzen, die höheren Armeeoffiziere sowie die leitenden Kader der öffentlichen Verwaltungen, ja selbst der öffentlichen Unternehmen und Institutionen, "entbindet sie ihrer Funktionen und setzt sie gegebenenfalls auf Vorschlag der Regierung ab". Wenn auch gemäss Verfassungsdekret die richterliche Gewalt von der gesetzgebenden und der ausführenden Gewalt getrennt und die Magistraten einzig der 'Autorität des Gesetzes' unterworfen sind, behält der Präsident doch die Kontrolle über die Ernennung der höchsten Magistraten. 'wichtig: Abschnittsende und diesen Text nicht löschen !'2. Soziales und Kultur
2.1. Bevölkerung
Ungefähr 46,5 Millionen Einwohner (Schätzung von 1996) leben auf einer Fläche von 2'345'409 km² (Bevölkerungsdichte: 19 Einw./km²). 40% der Bevölkerung lebt in Städten; allein in Kinshasa, der Hauptstadt, leben 4,8 Millionen Einwohner. Die ungefähr 250 Ethnien des Landes können in fünf Gruppen unterteilt werden: Die erste Gruppe wird durch die Bantu-Völker (80% der Bevölkerung) gebildet; deren hauptsächlichste Ethnien sind: Luba (1987 stellten sie 18% der Bevölkerung), Mongo (17%), Kongo (12%), und Ruanda [Hutu und Tutsi] (10%). Weitere Bantu-Völker von Interesse: Lunda, Tchokwé, Tetela, Bangala, Shi, Nande, Hunde, Nyanga, Tembo und Bembe. Die restlichen Völker sind die Sudanesen (Ngbandi, Ngbaka, Mbanja, Moru-Mangbetu und Zande), die Niloten (Alur, Lugbara und Logo), die Hamiten (Hima) und die Pygmäen (Mbuti, Twa, Baka, Babinga). Diese letztere Gruppe zählt zwischen 20'000 und 50'000 Personen.2.2. Sprache
Das Französische ist Amtssprache. Vier Nationalsprachen haben sich durchgesetzt: Suaheli (oder Kisuaheli) - und insbesondere der Kingwana-Dialekt - Lingala, Kikongo und Tschiluba.2.3. Religion
Die Demokratische Republik Kongo ist ein Land mit christlicher Mehrheit (der Animismus ist jedoch nach wie vor wesentlicher Bestandteil der Kultur). Die katholischen (50% der Bevölkerung, 1996), protestantischen (20%) und kimbanguistischen Kirchen (10%) - wichtigste Kirche afrikanischen Ursprungs - sind die bedeutendsten christlichen Gemeinden des Landes. Es gibt ebenfalls muslimische Gemeinschaften (10%), die Israeliten und die Griechisch-Orthodoxen, sowie zahlreiche religiöse Randgemeinschaften, darunter insbesondere die Zeugen Jehovas.2.4. Schul- und Bildungswesen
Obligatorische Schulpflicht besteht für Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren. Die Unterrichtssprache ist Französisch. Es wird unterschieden zwischen Primar- (sechs bis elf Jahre), Sekundar- (zwölf bis 17 Jahre) und Universitätsstufe (ab 18 Jahren). Das Land zählt mehrere bedeutende höhere Mittelschulen, die im allgemeinen in allen Städten und regionalen Hauptorten zu finden sind, sowie sieben öffentliche oder private Universitäten: Kinshasa (UNIKIN), Lubumbashi (UNILU), Kisangani (UNIKIS) und Kananga (UNIKA), weiter die Universität von Bas-Kongo in Kisantu (UNIBAC), die Universität von Ouest-Kongo (U.O.C.) und die Universität von Mbuji Maji. Analphabetismus (Schätzung 1995): 22,7% (Männer: 10,4% / Frauen: 32,3%).2.5. Medizinische Infrastruktur
Das Land ist theoretisch in 306 Gesundheitszonen aufgeteilt. In jeder Zone befinden sich im Durchschnitt 20 Ambulatorien mit dem Auftrag, die schweren Fälle in die sogenannten 'Referenzspitäler' (eines pro Zone) zu schicken. 1994 wurde im Rahmen des 'Entwicklungsprogrammes der Vereinten Nationen' festgestellt, dass nur etwa 50 dieser Zonen funktionierten. Die meisten Spitalzentren, gebaut in der Kolonialzeit, befinden sich in einem stark vorgerückten Zerfallstadium. Dies trifft ganz besonders für die grösste medizinische Einrichtung des Landes, das Spital von Kinshasa (ehemals 'Mama Yemo') zu (2'500 Plätze). Es trifft zwar zu, dass die Verhältnisse in diesem Spital in der letzten Zeit verbessert werden konnten, nicht zuletzt vor allem dank internationaler Zusammenarbeit. Dies brachte im Verlaufe von 1996 denn auch eine Verminderung der Zahl der Todesfälle (1'305 verzeichnete Todesfälle) im Vergleich zu 1993 (4'000). Da aber jegliche Finanzierung der Kankenpflegekosten fehlt und sogar die Löhne des medizinischen Personals nicht bezahlt werden, muss jedermann, der Zugang zu den öffentlichen Spitälern haben will, sämtliche Kosten einer Hospitalisierung selbst tragen. Diese Zustände haben zu extremen Praktiken geführt. So starben beispielsweise 3'515 Personen, welche 1996 vom Spital in Kinshasa abgewiesen wurden, 'ausserhalb des Spitals', weil sie keine 'Eintrittskaution' (welche sich im März 1997 auf acht Millionen NZ belief) - erbringen konnten. Es gab ausserdem Patienten, welche mehrere Wochen, ja sogar mehrere Monate warten mussten, um operiert zu werden, weil sie nicht in der Lage waren, sich das für die Operation erforderliche Material zu verschaffen oder zu bezahlen. Im Juni 1997 wandten sich die Leute an die Soldaten der AFDL (siehe Kapitel 15.1.), um Kranke und Kleinkinder, welche die Spitalverwaltung wegen Nichtbezahlung von Rechnungen als 'Geiseln genommen hatte', aus dem Spital zu holen. Die mangelnde Organisation und das Fehlen staatlicher medizinischer Einrichtungen führten zu einer explosionsartigen Entwicklung des Privatsektors, dessen Kosten für Hospitalisierung und ambulante Behandlung nur für eine Minderheit von Wohlhabenden bezahlbar sind. In Kinshasa ist für den Patienten, welcher über die erforderlichen Mittel (vorzugsweise in Dollars) verfügt, praktisch jede Pflege und Behandlung oder jeder chirurgische Eingriff verfügbar. In allen wichtigsten privaten Spitaleinrichtungen gibt es kompetentes medizinisches und paramedizinisches Personal, welches in der Lage ist, den Kranken jede erdenkliche medizinische Dienstleistung zur Behandlung des physischen und psychischen Zustands angedeihen zu lassen. Mangels finanzieller Mittel muss sich die überwiegende Mehrheit der Kranken mit den kleinen Ambulatorien beschränken, welche von karitativen Organisationen, wie beispielsweise der 'Heilsarmee', welche in Kinshasa 19 'Gesundheitszentren', drei Entbindungskliniken, drei Zahnkliniken und sieben 'Ernährungszentren' besitzt, unterhalten werden. In den abgelegenen Regionen des Hinterlandes hat die Bevölkerung keine andere Wahl als die traditionelle Medizin, oder sie frönt der Selbstmedikation (Vergiftungsrisiken). Zahlreiche Kranke geben sich fetischistischen und okkulten Praktiken, ja sogar intensiven Gebetssitzungen und Wunderheilungen hin. In einem solchen Umfeld richten einstmals ausgerottete Krankheiten (Masern, Typhus, Ruhr, usw.), sogar AIDS erneut Verheerungen an. Im April 1997 wurden an verschiedenen Orten des Landes Cholera- und Hirnhautentzündungs-Epidemien festgestellt. Die Zunahme der verzeichneten Todesfälle weist auf die schwierige medizinische Lage in der Demokratischen Republik Kongo hin.3. Frau und Familie
Die kongolesischen Frauen sind im Verhältnis zum Manne in vielen Bereichen stark benachteiligt. Nach Gesetz und selbst nach Gewohnheitsrecht ist die Frau praktisch ganz vom Manne abhängig. Nach dem Familienrecht ist 'der Mann der Haushaltsvorstand. Er schuldet seiner Frau Schutz, die Frau dem Manne Gehorsam' (Art. 444). Dieses Gesetz sieht ebenfalls vor, dass 'die Frau für alle Rechtshandlungen, mit welchen sie sich zu einer Leistung verpflichtet, für welche sie persönlich haftet, der Zustimmung des Ehemannes bedarf' (Art. 448). Desgleichen darf die Ehefrau, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, in zivilrechtlichen Angelegenheiten kein Gerichtsverfahren anstrengen, und ohne die Zustimmung des Ehemannes, nicht einmal 'erwerben, veräussern oder sich verpflichten'. Auch wenn die elterliche Gewalt über die Kinder von Vater und Mutter gemeinsam ausgeübt wird, ist bei Unstimmigkeiten der Wille des Vaters massgebend (Art. 317). Die Frauen sind überdies Opfer des ewigen Konflikts zwischen 'Gewohnheits'- und 'geschriebenem' Recht. Zum Beispiel sieht das Gesetz zwar vor, dass Mädchen sich nicht vor dem vollendeten 15. Altersjahr verheiraten dürfen (Knaben: 18 Jahre ); dennoch ist es fast überall Sitte, dass die Eltern ihre Töchter gegen ihren Willen zur Heirat zwingen können, was meist vor der Pubertät der Fall ist. Das erklärt auch, warum viele Frauen nicht eingeschult werden oder die Primarschule sehr früh verlassen. Die Analphabetenquote der Frauen (32,3% im Jahre 1995) übersteigt somit den Landesdurchschnitt (22,7%) bei weitem. Weil meistens die Frauen den Unterhalt der Familie bestreiten müssen, sind sie auch als erste vom wirtschaftlichen und sozialen Niedergang betroffen. Die Not treibt die Frauen und die jungen Mädchen immer mehr in die Prostitution, wo sie sich grossen Risiken, wie beispielsweise der Ansteckung mit AIDS, aussetzen (die Prostitution wird als Hauptgrund für die Verbreitung des Virus in der Demokratischen Republik Kongo angesehen). Zu erwähnen ist auch, dass die Beschneidung der jungen Mädchen in den ländlichen Gebieten im Norden des Landes weiterhin praktiziert wird. Die ethnischen Konflikte im Osten des Landes und der folgende Bürgerkrieg haben die an sich schon schwierige Lage der kongolesischen Frauen noch verschärft. Zahlreiche von ihnen wurden Opfer von Vergewaltigungen oder besonders schweren körperlichen Misshandlungen von Seiten der Armee, der Sicherheitskräfte und selbst von Seiten von Zivilpersonen, dies ohne irgendwelche Bestrafung. Kürzlich wiesen Menschenrechtsvereinigungen auf die Schikanen hin, welche Frauen in Kinshasa durch Angehörige der AFDL (siehe Kapitel 15.1.) erdulden mussten, weil sie Hosen, Miniröcke oder Strumpfhosen trugen. So geschah es zwischen Ende Mai und Anfang Juni 1997, dass den Frauen und jungen Mädchen die Hosen zerrissen oder zerschnitten wurden, und es gab sogar Frauen, welche geschlagen und auf offener Strasse nackt ausgezogen wurden, dies im Namen einer 'puritanischen Moral', wie sie vom neuen Regime propagiert wird.4. Medien
4.1. Nachrichtenagenturen
- ACP 'Agence Congolaise de Presse'. Ursprünglich 'Agence Zaïre Presse'. 100% staatlich, geführt von Ali Kalonga. Pressemitteilungen erscheinen in Französisch.
- DIA 'Documentation et Informations Africaines'. Presseagentur der katholischen Kirche.
4.2. Zeitungen und Zeitschriften
Zeitungen:- Elima: Abendzeitung, 1973 gegründet. Erscheint in Kinshasa. Anfänglich regierungstreu, seit Mitte 1990 auf Seiten der Opposition. Auflage: Zwischen 3'000 und 5'000 Exemplaren. Herausgeber und Eigentümer: Thy-René Essolomwa Nkoy Ea Linganga.
- Salongo: Morgenzeitung, 1973 gegründet. Erscheint in Kinshasa. Gilt als dem alten Regime nahestehend.
- Umoja: Tageszeitung der Opposition, 1990 gegründet. Erscheint in Kinshasa. Eigentümer: Léon Moukanda Loungama.
Zeitschriften:- La Conscience. Unabhängige christliche Wochenzeitung; 1991 gegründet.
- Forum des As. Wochenzeitung, erscheint seit 1991 in Kinshasa.
- Le Manager grognon. Satirische Wochenzeitung, erscheint in Kinshasa.
- Le Palmarès. Wochenzeitung, 1992 gegründet. Während kurzer Zeit im August 1993 eingestellt.
- Le Phare. Wochenzeitung, 1984 gegründet. Erscheint in Kinshasa. Eigentümer: Polydor Muboyayi Mubanga.
- Le Potentiel. Erscheint seit 1986 zweimal wöchentlich in Kinshasa. Eigentümer: Modeste Mutinga Mutuishayi.
- La Référence Plus. Wochenzeitung, erscheint seit 1992 in Kinshasa.
- La Renaissance. 1964 gegründet, zwischen 1973 und 1989 verboten.
- Le Soft de Finance. Wochenzeitung. Auflage ungefähr 8'000 Exemplare.
- La Tempête des tropiques. Wochenzeitung, erscheint in Kinshasa.
- Temps Nouveau. Der UFERI nahestehende Wochenzeitung, 1991 gegründet.
4.3. Radio
- Radio Congolaise. Ehemals 'Voix du Zaïre': Nationales Radio (100% staatlich). Sendet in Französisch sowie in den vier wichtigsten Landessprachen. Das kongolesische Radio kann dank dem nationalen Sender in Kinshasa und den acht Provinzsendern in den Hauptorten der jeweiligen Regionen fast im ganzen Land empfangen werden.
- Radio Candip 'Centre d'Animation et de Diffusion Pédagogique'. Sendet aus Bunia (Ostprovinz) in Französisch, Suaheli, Lingala und in 16 weiteren Lokalsprachen. Wurde Mitte Februar 1997 durch die AFDL besetzt und übertrug für die Allianz Mitteilungen unter dem Bezeichnung 'Die Stimme des Volkes' (La Voix du Peuple).
- Radio Catholique de Kinshasa. Privatstation der christlichen Gemeinschaft in Kinshasa; behauptet, im Dienste der ganzen Bevölkerung zu stehen. Ihre Einrichtungen wurden von der italienischen Bischofskonferenz finanziert; die Betriebskosten werden vom Erzbischof von Kinshasa übernommen. Sie arbeitet seit Oktober 1995 und sendet zwölf Stunden pro Tag.
- Radio Sango Malamu. Privatradio einer ursprünglich amerikanischen protestantischen Gemeinschaft. Sendet 16 Stunden pro Tag (von 05.00 bis 21.00 Uhr). Trotz seiner gleichförmigen Botschaft wird es viel gehört: Es sendet vom Morgen bis zum Abend religiöse Musik und Bibelzitate. Radio Sango Malamu gilt als Persönlichkeiten aus dem Umfeld von Ex-Präsident Mobutu nahestehend.
- RTTF 'Radio Tam-Tam Fraternité'. Geheimsender der Opposition, wird auch 'Radio Liberté' genannt. Gegründet im Mai 1993, hat er nur während drei Monaten jeweils 30 Minuten pro Tag (von 5.00 bis 5.30 Uhr) gesendet.
4.4. Fernsehen
- Télévision Congolaise. Ehemals 'Télé-Zaire'. Nationales Fernsehen (100% staatlich). Sendet in Französisch sowie in den vier wichtigsten Landessprachen. Im Juli 1997 begann die 'Radio-Télévision Nationale Congolaise' (RTNC) unter der Führung von Juliane Lumumba (Tochter des Nationalhelden Patrice Lumumba), die Fernsehsendungen über Satellit zu übertragen. Sie wurden im Dezember 1994 aus Mangel an Mitteln für die Reparatur der Einrichtungen der Station und für die Bezahlung der 'Intersat'-Rechte eingestellt.
- TKM 'Télé Kin Malebo'. Privatfernsehen mit Sitz in Kinshasa; der Eigentümer, Ngongo Luwowo, wird als dem Ex-Präsidenten Mobutu nahestehend erachtet. Im Juni 1997 wurde TKM beschuldigt, sich einen Teil der dem ehemaligen 'Office Zaïrois de Radio et Télévision' (OZRT) gehörenden technischen Installationen angeeignet zu haben, weshalb die neuen kongolesischen Behörden beschlossen, TKM zu verstaatlichen, und es zum zweiten Kanal des neuen kongolesischen Fernsehens zu machen.
5. Wirtschaft
5.1. Volkswirtschaft
Die Demokratische Republik Kongo besitzt wichtige Bodenschätze (Kupfer, Kobalt, Diamanten, Gold) sowie einige Erdölvorkommen. Der Wald, der mehr als 77% des Landes bedeckt, ist eine andere wichtige Quelle natürlichen Reichtums. 80% der Bevölkerung ist in der Landwirtschaft tätig. Die Hauptprodukte sind Kaffee, Kakao, Palmöl, Mais, Maniok, Baumwolle und Bananen. Der potentielle Reichtum (insbesondere Bodenschätze und landwirtschaftliche Ressourcen) macht die DR Kongo theoretisch zu einem der wichtigsten Länder des Kontinents, in Tat und Wahrheit ist das Land jedoch, gemessen am Pro-Kopf-Einkommen, eines der ärmsten Länder der Welt. Die Krise trifft die Bevölkerung sehr hart und macht das Leben, beziehungsweise das Überleben, für die Mehrheit der Kongolesen sehr schwierig. 1994 war das durchschnittliche jährliche Pro-Kopf-Einkommen auf 125.-- US $ gefallen (1990: 160.-- US $). In der gleichen Zeitspanne wurde eine stark negative Zuwachsrate verzeichnet (- 16,2%). Heute ist das Land ausgeblutet. Die Staatskasse ist praktisch in Konkurs und überlebt nur dank der Zölle, der Bergbaukonzessionen und der bescheidenen Einkommen einiger staatlicher Unternehmen. Zwar stiegen die Steuereinnahmen zwischen Mai und Juni 1997 von 2,5 auf 6,5 Millionen Dollar an, dennoch bleibt die Steuerhinterziehung nach wie vor stark verbreitet. Die öffentlichen Dienstleistungen sind praktisch nicht vorhanden. Die Infrastrukturen sind zum grössten Teil zerfallen. Die Strassen sind in sehr schlechtem Zustand. Die Telekommunikation und die Postdienste funktionieren bestenfalls unregelmässig. Die landwirtschaftliche und die industrielle Produktion sind an einem Tiefpunkt angelangt. Auch die Bergbauproduktion ist praktisch verschwunden. So beträgt die Kupferproduktion, welche sich 1976 auf 506'000 Tonnen belief, heute nur noch ungefähr 38'000 Tonnen. Nach Schätzungen wird ausserdem 80% der Diamantproduktion illegal exportiert. Ferner beläuft sich die Auslandsschuld des Landes nach Angaben des neuen Finanzministers auf 14 Milliarden US $. Der wirtschaftliche Wiederaufbau des Landes stellt eine der grössten Herausforderungen für das neue Regime dar. Dieses hat übrigens Ende Mai 1997 einen Aufbauplan für das Land angekündigt, welcher folgende Schwerpunkte vorsieht: Erneuerung der Strasseninfrastruktur, Schaffung von mechanisierten Betrieben und Ausbildungszentren für die Landwirtschaft in verschiedenen Regionen, Elektrifizierung des ganzen Landes, Wiederherstellung des Gesundheitssystems - insbesondere durch den Bau neuer Spitäler - und die Errichtung eines Informatikzentrums mit dem Auftrag, Angebot und Nachfrage von Stellen zusammenzufassen. Seither hat die AFDL bereits Verträge für die Ausbeutung der Bodenschätze ausgehandelt und unterzeichnet, insbesondere mit südafrikanischen, amerikanischen und kanadischen Firmen. Ausserdem ist es ihr gelungen, die Hyperinflation, welche das Land auszehrt, etwas einzudämmen. So fiel die Inflation im Mai 1997 von 900% auf 20%.5.2. Beschäftigungssituation
In einem Land, in welchem der offizielle Sektor nicht mehr als ca. 30% der Wirtschaft ausmacht, erreicht die Arbeitslosigkeit - nach Schätzungen - die Rekordhöhe von 70% der erwerbstätigen Bevölkerung. Während Jahren waren die Arbeitskräfte und Beamten, denen der magere Lohn oft verspätet oder überhaupt nicht ausgerichtet wurde, gezwungen, verschiedene Tätigkeiten auszuüben, um zu überleben, sei dies nun Zigarettenhandel oder der Verkauf von Gemüse aus ihrem Garten. Diese Zustände haben zur Entwicklung eines blühenden inoffiziellen Sektors (Schwarzmarkt, Familienkleinhandel, kleinere Aufträge) beigetragen und die allgemeine Korruption auf allen Ebenen begünstigt. Vor allem bei den Beamten war es zur Regel geworden, dass sie ihre Löhne aufbesserten, indem sie für jeden Dienst Schmiergelder verlangten. Zwar erhielten die Beamten Ende Juni 1997 zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder ihren mageren Lohn (zwischen neun und 38.-- US $), jedoch nicht die rückständigen Löhne, wie sie sich erhofften. Desgleichen hat die neue Regierung Ende Juni 1997 die bevorstehende Aufhebung von Stellen in der Staatsverwaltung angekündigt, dies im Hinblick auf eine Erneuerung der überbordenden Verwaltung mit ungefähr 470'000 Angestellten.5.3. Währung
Währungseinheit: Der 'Nouveau Zaire' (NZ), eingeführt im Oktober 1993. 1 NZ = 100 'Neue Makuta' (nouveaux makuta) (Einzahl: 'Neuer Likuta' [nouveau likuta]). Wechselkurs in Kinshasa (April 1997): 1 US $ = 170'000 NZ Zugelassene Banknoten: 1'000, 5'000, 10'000, 20'000 und 50'000 NZ. Die Ende 1996 eingeführten Banknoten von 100'000, 500'000 und 1'000'000 NZ (volkstümlich 'Prostates' genannt), wurden von der neuen Regierung ausser Kraft gesetzt; sie versucht, sie allmählich aus dem Verkehr zu ziehen. Ende Mai 1997 gab der Finanzminister - ohne genaue Daten zu nennen - die bevorstehende Ausgabe eines 'Kongolesischen Frankens' (Franc Congolais, FC) bekannt; er soll Schritt für Schritt den 'Nouveau Zaïre' ablösen. Es wurde auch präzisiert, dass bis zur Einführung des neuen Geldes keine Banknoten gedruckt werden. Theoretisch wird ein Kongolesischer Franken gegen 540'000 NZ einzutauschen sein, und 3 FC gegen 1 US $.6. Mobilität
6.1. Kommunikationsmittel
Theoretisch verfügt die Demokratische Republik Kongo über ein 146'500 km langes Strassennetz (davon sind jedoch lediglich 2% asphaltiert), ein 5'254 km langes Eisenbahnnetz und 15'800 km Wasserwege. Dazu kommen 44 Flughäfen, davon vier internationale (Kinshasa, Lubumbashi, Goma und Bukavu). In Wirklichkeit ist der Strassen-, Eisenbahn-, Fluss- und Binnenverkehr jedoch immer weniger gewährleistet, weil Strassen und Schienen nicht gepflegt und die Wasserwege nicht genügend ausgebaggert werden. Ausserdem sind die Verkehrsverbindungen nicht immer gleich gut, vor allem in der Regenzeit (Süden: Oktober-April; Norden: Mai-September) und das Transportmaterial ist veraltet und überholt. Um beispielsweise von Kinshasa auf der Strasse nach Kisangani (Ostprovinz) zu gelangen, benötigt man für die etwa 1'400 km lange Strecke im besten Fall drei Wochen. Reisende, die sich von einer Region in eine andere begeben wollen, sind gezwungen, das Flugzeug zu nehmen, was sich allerdings die Mehrheit der Kongolesen nicht leisten kann. Die einzige Alternative zum Flugzeug bieten Schiffe, die gelegentlich auf den Binnenwasserwegen kreuzen. In diesem Fall braucht man für die Strecke Kinshasa-Kisangani ungefähr zehn bis 15 Tage. Die Demokratische Republik Kongo kann auf verschiedenen Wegen verlassen werden. Von Kinshasa (Internationaler Flughafen Ndjili) gibt es Flüge nach Brüssel, Paris, Lissabon, Genf/Zürich und Johannesburg. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich mit einem Inlandflug in den Osten des Landes zu begeben und von dort nach Ruanda oder in ein anderes angrenzendes Land weiterzureisen, wo Flüge nach Europa angeboten werden. Man kann auch nach Brazzaville (Republik Kongo) gelangen, entweder über den Kongo-Fluss (mit der Fähre oder einer Piroge) oder, wenn dies machbar ist, mit einem Touristenflugzeug (Flughafen Ndolo). Von Brazzaville aus können europäische Destinationen angeflogen werden (z.B. Genf/Zürich, Paris, Moskau). Schliesslich besteht auch die Möglichkeit, im Hafen von Matadi, mitunter auch heimlich, an Bord eines Frachtschiffes zu gehen, das einen dann nach Europa (vor allem nach Italien und Belgien) bringt.6.2. Reisepapiere
Der letzte Reisepass mit der Aufschrift 'République du Zaïre' auf dem Deckblatt wurde Ende 1995 herausgegeben. Im Unterschied zum ehemaligen Pass unterscheidet er sich vor allem durch ein kleineres Format (9 x 12 cm anstelle von 10 x 15 cm). Ausserdem umfasst er 32 Seiten, statt wie beim früheren Modell 36 Seiten. Zudem sind die Rubriken auf den Seiten 2, 3 und 4 vertikal angeordnet (früher: horizontal), während das Photo des Inhabers horizontal unten links auf Seite 3 angebracht ist (früher: auf Seite 3 oben in der Mitte vertikal angeordnet). Es gibt drei verschiedene Passmodelle, das heisst: den gewöhnlichen 'Pass' (Passeport, mit grünem Umschlag), den 'Dienstpass' (Passeport de service, blau) und den 'Diplomatenpass' (Passeport diplomatique, bordeauxrot). Am 8. Februar 1997 wurde in der Presse bekannt, dass die AFDL damit begonnen habe, seit dem 6. Februar 1997 gewöhnliche Reisepässe mit der Aufschrift 'République démocratique du Congo' auszuliefern. Diese Meldung wurde von den neuen kongolesischen Behörden allerdings noch nicht bestätigt. Auch wir wurden bis zum Zeitpunkt der Redaktion des Länderinformationsblattes mit keinen derartigen Dokumenten konfrontiert. Die ehemalige Identitätskarte (grün mit mehreren faltbaren Seiten und mit der Aufschrift 'République du Zaïre'), war oft Gegenstand missbräuchlicher Verwendung (Diebstahl von Blanko-Identitätskarten, Abänderungen, Fälschungen, usw.). Sie sollte deshalb durch eine neue plastifizierte Identitätskarte (einseitig, Format 10 x 8,4 cm) ersetzt werden, die im Januar 1987 in Umlauf kam. Dieses Vorhaben wurde gegen Ende 1988 gestoppt, weil es nur in den wichtigsten Agglomerationen des Landes, wie in der Hauptstadt Kinshasa, durchgeführt werden konnte. Seither haben gewisse 'Zonen' - das heisst diejenigen Instanzen, welche für die Ausgabe der Identitätskarten zuständig sind - wiederum die alten amtlichen Formulare, obwohl formell ausser Kraft, ausgegeben. Im Zeitpunkt der Redaktion des vorliegenden Dokumentes gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass die neuen Behörden ein neues Modell einer Identitätskarte in Umlauf bringen würden. Quelle: Stat. Bundesamt. Länderbericht Zaïre 94. Wiesbaden. 1995, S. 12.7. Regierung
7.1. Staatsoberhaupt
Am 17. Mai 1997 proklamierte sich der Führer der AFDL, Laurent-Désiré Kabila, in einer neun Punkte enthaltenden Mitteilung, selbst zum Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo. Seine Amtseinsetzung erfolgte am 29. Mai 1997 im 'Stade des martyrs de la Pentecôte' von Kinshasa.7.2. Landesregierung
Die Regierung zählt 20 Minister und drei Stellvertretende Minister. 13 Minister wurden am 22. Mai 1997 nominiert, zwei Minister und ein Stellvertretender Minister am 6. Juni 1997 und fünf Minister und zwei Stellvertretende Minister am 13. Juni 1997. Ministerliste (Stand: 9.7.1997) Verteidigung (und Staatschef): Laurent-Désiré Kabila Auswärtige Angelegenheiten: Bizima Karaha Inneres: Mwenze Kongolo Finanzen: Mawampanga Mwana Nanga Wirtschaft, Industrie und Handel: Pierre-Victor Mpoyo Information und Kultur: Raphael Ngenda Justiz: Célestin Lwangi Bergbau: Matukula Kambale Planung und Entwicklung: Babi Mbayi Post und Telekommunikation: Paul Kinkela Vi Kan'si Transportwesen: Henri Mova Sakani Gesundheit und Soziales: Jean-Baptiste Sondji Erziehung: Kamara Wa Kahikara Landwirtschaft: Paul Bandoma Öffentliche Dienstleistungen: Justine Mpoyo Kasavubu Internationale Zusammenarbeit: Thomas Kanza Nationaler Wiederaufbau undDringende Arbeiten: Etienne Richard Mbaya Hoch- und Tiefbau: Anatole Tchubaka Bishikwabo Energie: Pierre Lokombo Kitete Jugend und Sport: Vincent Mutombo Tshibal Umwelt und Fremdenverkehr: Eddy Angulu Mabangi Die stellvertretenden Minister sind Juliana Lumumba (Information), Milulu Mamboleo (Soziales) und Faustin Munene (Inneres).
8. Parlament
Das letzte Parlament - genannt 'Hoher Rat der Republik / Übergangsparlament' (Haut Conseil de la République / Parlament de transition, HCR/PT) - war am 26. Januar 1994 konstituiert und vom Erzbischof von Kinshasa, Mgr. Laurent Monsengwo präsidiert worden. Es wurde formell durch die AFDL, gestützt auf das am 28. Mai 1997 erlassene 'Verfassungsdekret Nr. 003 vom 27. Mai 1997 über die Organisation und die Ausübung der Staatsgewalt in der Demokratischen Republik Kongo' (Décret constitutionnel No 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo) aufgehoben. In seiner Einsetzungsrede am 29. Mai 1997 legte der Staatschef, Laurent-Désiré Kabila, einen Fahrplan für den Übergang vor, welcher die Bildung einer verfassunggebenden Versammlung für den 30. Juni 1998 vorsieht.9. Verwaltung
Das Land umfasst folgende Provinzen: Bas-Congo (Matadi), Bandundu (Bandundu), Equateur (Mbandaka), Katanga (Lubumbashi), Kasaï Oriental (Mbuji-Maji), Kasaï Occidental (Kananga), Nord-Kivu (Goma), Süd-Kivu (Bukavu), Maniema (Kindu), Province Orientale (Ostprovinz) (Kisangani) sowie die Region Kinshasa (Hauptstadt). Seit der Machtübernahme durch die AFDL haben zwei Provinzen eine Namensänderung erfahren: 'Bas-Congo' (ehemals 'Bas-Zaïre') und Province Orientale oder 'Haut-Congo' (ehemals 'Haut-Zaïre'). Verwaltungseinheiten: Regionen (oder Provinzen), Unterregionen, Zonen und Kollektive. Quelle: Federal Research Division, Library of Congress. Zaire, a country study. (4th Ed.) Washington DC. 1994, S. 34 (modifiziert).Wahlen
Bei den letzten Präsidentschaftswahlen, die am 28. und 29. Juli 1984 stattfanden, wurde Marschall Mobutu (einziger Kandidat) mit einem Stimmenanteil von 99,16% wiedergewählt. Bei den letzten Parlamentswahlen, die am 6. September 1987 stattfanden, wurden 250 Abgeordnete von insgesamt 1'075 Kandidaten ins Parlament (Assemblée nationale) gewählt, wobei die meisten dem 'Mouvement Populaire de la révolution' (MPR, ehemals Einheitspartei) nahestanden. Die Stimmabgabe war bei beiden Wahlen obligatorisch. Neue Präsidentschafts- und Parlamentswahlen waren für Juli 1997 vorgesehen. Sie haben allerdings wegen des Bürgerkriegs und der Machtergreifung durch die AFDL noch nicht stattgefunden. In seiner Einsetzungsrede am 29. Mai 1997 legte der Staatschef, Laurent-Désiré Kabila, einen Fahrplan für den Übergang vor, welcher die Durchführung von Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im April 1999 vorsieht.11. Recht und Gerichtswesen
11.1. Recht
Das kongolesische Rechtssystem (Gesetz über die Organisation und die Zuständigkeit der Gerichte vom 31. März 1982) ist durch die Kolonialzeit und das belgische Erbe beeinflusst. Das Gewohnheitsrecht nimmt allerdings einen wichtigeren Stellenwert ein, insbesondere auf dem Gebiet des Familien-, Ehe- und Erbrechts. Nach der Machtübernahme im Mai 1997 versicherten die neuen kongolesischen Behörden, sie hätten nicht die Absicht, das bestehende Gerichtswesen zu ändern. Das 'Verfassungsdekret Nr. 003 vom 27. Mai 1997 über die Organisation und die Ausübung der Staatsgewalt in der Demokratischen Republik Kongo' (Décret constitutionnel No 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo) hat diese Absicht bekräftigt. Artikel 11 dieses Dekrets erklärt zumindest formell die Justiz als unabhängig, während Artikel 12 die Rechtsprechung den Gerichten überträgt. Was die Gesetzestexte anbelangt, bestimmen die Artikel 13 und 14 des Dekrets Nr. 003, dass 'die bestehenden Gesetzes- und Reglementstexte '...' bis zum Zeitpunkt ihrer Aufhebung in Kraft bleiben', es sei denn sie stünden im Widerspruch zum besagten Dekret. Das bedeutet, dass die Mehrzahl der Gesetzestexte - insbesondere das Strafrecht, die Gerichtsorganisation oder das Familienrecht - zur Zeit immer noch in Kraft sind.11.2. Ordentliche Gerichte
Friedensgerichte (Tribunaux de Paix). In jeder ländlichen Zone und in jeder Stadt befindet sich ein Friedensgericht. Es befasst sich mit Streitigkeiten im Bereich des Familien- und Bodenrechts sowie mit anderen geringfügigen Rechtsstreitigkeiten. Obergerichte (Tribunaux de Grande Instance). In jeder Stadt und in jeder Teilregion befindet sich ein Obergericht. Es befasst sich mit Vergehen, die mit dem Tode, mehr als fünf Jahren Zuchthaus oder Zwangsarbeit bestraft werden. Die Obergerichte sind ebenfalls die Beschwerdeinstanz für erstinstanzliche Urteile der Friedensgerichte. Appellationsgerichte (Cours d'Appel). Es gibt ein Appellationsgericht in jeder Region sowie in Kinshasa. Sie befassen sich erstinstanzlich mit Vergehen von Magistraten und Beamten der öffentlichen und der parastaatlichen Verwaltung. Die Appellationsgerichte sind ebenfalls zuständig für Beschwerden gegen Urteile der Obergerichte. Oberster Gerichtshof (Cour Suprême de Justice). Der Oberste Gerichtshof hat seinen ständigen Sitz in Kinshasa. Seine Rechtsprechung erstreckt sich auf das ganze Territorium der Republik. Er ist erstinstanzlich zuständig für Vergehen von Ministern, Regionalgouverneuren, Richtern der Allgemeinen Staatsanwaltschaft der Republik (Parquet Général de la République) und des Obergerichts. Er ist ebenfalls zuständig bei Beschwerden gegen erstinstanzliche Urteile des Appellationsgerichts.11.3. Sondergerichte
Die neuen Behörden erklärten von Anfang an, dass kein Sondergericht geschaffen werde, weil 'die ordentlichen Gerichte genügen, um die Schuldigen zu beurteilen'. Zur Zeit der Redaktion des vorliegenden Informationsblattes war uns denn auch keine ausserordentliche Gerichtsbarkeit bekannt.11.4. Militärgerichte
Als Folge der Niederlage der Zairischen Streitkräfte 'Forces Armées Zaïroises', FAZ), bleiben hinsichtlich des Militärrichteramtes einige Unklarheiten. Das 'Verfassungsdekret Nr. 003 vom 27. Mai 1997' enthält keinen ausdrücklichen Bezug auf die frühere Militärgerichtsbarkeit. In Anbetracht des Wortlauts der Artikel 11 bis 14 (vgl. Kap. 11.1.), kann indessen davon ausgegangen werden, dass diese Instanzen - welche durch das Militärgesetzbuch (vgl. die Gesetzesverordnung Nr. 72/060 vom 25. September 1972) geregelt sind - weiterhin Bestand haben, zumindest rechtlich gesehen. Die Militärgerichte sind wie folgt strukturiert: Polizeikriegsräte (Conseils de Guerre de Police). Je einer pro Territorialbereich des 'Garnisonskriegsrates' (Conseil de Guerre de Garnison). Er besteht aus einem Mitglied - das heisst dem Ersten Stellvertreter oder Stellvertreter des Militärauditors beim Garnisonskriegsrat. Er ist zuständig für alle strafbaren Handlungen, welche mit Zwangsarbeit bis höchstens einem Jahr, mit Busse und Degradierung geahndet werden. Garnisonskriegsräte (Conseils de Guerre de Garnison). Ein Garnisons-kriegsrat pro Teilregion, in welcher eine Garnison besteht. Die Garnisonskriegsräte beurteilen alle nicht mit der Todesstrafe geahndeten Handlungen, die von den Angehörigen der Streitkräfte im Rang unterhalb des Majors begangen werden, sowie alle diejenigen Personen, welche nicht Militäreigenschaft haben, aber dennoch der Militärgerichtsbarkeit unterstehen. Höhere Kriegsräte (Conseils de Guerre Supérieurs). Einer pro Militärbezirk (total elf). Die Höheren Kriegsräte sind zuständig für alle von Militärangehörigen mit Grad unter einem Brigadier begangenen strafbaren Handlungen, sowie für alle Personen, welche nicht Militäreigenschaft haben, aber dennoch der Militärgerichtsbarkeit unterstehen. In Kriegszeiten, oder wenn der Belagerungs- oder Ausnahmezustand ausgerufen wird, sind sie zuständig für die Beurteilung der Angehörigen der feindlichen oder aufständischen Streitkräfte. Schliesslich sind sie zuständig für die Beurteilung der Angehörigen der Garnisonskriegsräte für jede in Ausübung ihrer Funktionen begangene strafbare Handlung. Generalkriegsrat (Conseil de Guerre Général). Ein einziger Generalkriegsrat für das gesamte Gebiet befindet sich in Kinshasa. Er beurteilt direkt die Admiräle und Generäle der Armee, sowie die Militärmagistraten, welche Mitglieder des Generalkriegsrates und der Höheren Kriegsräte sind, und die wegen Straftaten verfolgt werden, welche sie in Ausübung ihrer Funktionen begangen haben. Ihm obliegt schliesslich auch die Beurteilung von Nichtigkeitsbeschwerden gegen die Urteile der unteren Instanzen wegen Rechtsverletzung, sowie die Beurteilung von Revisionsgesuchen.12. Militär und Sicherheitsorgane
12.1. Armee
Bis zur Niederlage der ehemaligen 'Forces Armées Zaïroises' (FAZ) war der Militärdienst freiwillig. Allerdings war die Möglichkeit einer obligatorischen Aushebung für den Konfliktfall sowie bei nationalem Notstand vorgesehen.- APNL - Nationale Volksbefreiungsarmee (Armée Populaire Nationale de Libération). Ehemals 'Nationale Volksbefreiungsarmee des Kongo' (Armée Populaire de Libération du Congo, APLC). Die neue nationale kongolesische Armee, welche zur Zeit auf freiwilliger Rekrutierung ihrer Angehörigen basiert, ist in verschiedener Hinsicht charakteristisch. Nebst der unbestreitbaren Präsenz von ausländischen Offizieren und Soldaten (vor allem Ruander und Ugander) in ihren Reihen, besteht die APNL in erster Linie aus Tutsi-Soldaten aus den 'Banyarwanda'- und 'Banyamulenge'-Gemeinschaften im Osten des Landes. Meist in Ruanda ausgebildet, erfahren, ruhig und sehr diszipliniert, sind sie die Eliteeinheiten der neuen Armee. Zu den Tutsi-Soldaten hinzu kommen die 'marxistischen' Kämpfer, welche aus der 'Partei der Volksrevolution' (Parti de la Révolution Populaire, PRP) stammen, sowie die Nachfolger der ehemaligen 'gendarmes katangais', welche innerhalb des 'Nationalen Widerstandsrates für die Demokratie' (Conseil National de Résistance pour la Démocratie, CNRD) kämpften. Letztere wurden vor allem in Angola ausgebildet. Ausserdem schlossen sich Hunderte von Deserteuren der Regierungsarmee der APNL bei ihrem siegreichen Vorstoss an. In der Zwischenzeit haben sich mehr und mehr junge Rekruten (meist im Alter zwischen 14 und 18 Jahren) aus andern Ethnien des Landes der APNL zur Verstärkung angeschlossen.
Am 25. Juni 1997 verkündete das staatliche Radio, dass die Soldaten, welche den verschiedenen Einheiten der ehemaligen 'Forces Armées Zaïroises' (Polizei, Zivilgarde, 'Präsidiale Spezialabteilung', usw.) angehörten, in der neuen kongolesischen Armee ausgebildet und in sie integriert würden. In diesem Sinne wurden sie vom neuen Regime aufgefordert, sich einem Programm zur Neuausbildung und Erneuerung in einem Ausbildungszentrum in Kitona (Bas-Congo), ungefähr 400 km südwestlich von Kinshasa, zu unterziehen. Viele von ihnen haben jedoch abgelehnt, weil sie es als erniedrigend empfanden.12.2. Polizei und Gendarmerie
- PNC - Nationale Kongolesische Polizei (Police Nationale Congolaise). Am 21. Juni 1997 gab das staatliche Radio die Bildung einer neuen Polizeieinheit, mit dem Namen 'Police Nationale Congolaise', bekannt. Sie ersetzt die ehemalige Antiterrorzivilgarde sowie die ehemalige Gendarmerie. Nach der gleichen Quelle ist die neue Polizei - wovon bereits 60 Mann in Kinshasa operieren - dazu bestimmt, 'in dringenden Notfällen' als schnelle Eingreiftruppe zu handeln. Die für die neue Polizei bestimmte Ausrüstung (umfassend Uniformen, Tränengasgranaten, Schutzmasken, Handschellen, Stiefel, Lautsprecher und Radios) wurde den neuen kongolesischen Behörden ausserdem von Südafrika geliefert.
12.3. Milizen
- Bangirima oder 'Ngilima'. Eine von den Kämpfern der autochthonen Völker von Nord-Kivu - insbesondere der Nande und Hunde -, sowie von Deserteuren der ehemaligen 'Forces Armées Zaïroises' gebildete Miliz. Den 'Banyarwanda' feindlich gesinnt, nahm sie anfänglich an zahlreichen Übergriffen der Regierungsarmee gegen die ruandischen Bevölkerung teil. Später, als die AFDL ihre Offensive gegen den Osten des Landes startete, schloss sie sich wiederum den Tutsi-Rebellen an.
- MAGRIVI - Vereinigung der Bauern und Viehzüchter der Virunga (Mutuelle des Agriculteurs et Eleveurs de la Virunga). Diese wurde 1989 in Nord-Kivu als Solidaritätsbewegung und Unterstützung der 'Banyarwanda'-Gemeinschaft gegründet. Zur Hauptsache aus "zairischen" Hutus bestehend, wandelte sie sich allmählich zu einer Selbstverteidigungsmiliz gegen die Angriffe der Milizen der autochthonen Ethnien (Hunde, Nande, Nyanga, usw.), und radikalisierte sich unter dem Einfluss der ruandischen Hutus (Interahamwé und Impuzamugambi), welche sich Mitte 1994 in die Gegend zurückzogen. Die Milizionäre der MAGRIVI zeichnen für Angriffe und Übergriffe in grossem Stil gegen die Gemeinschaft der Tutsi, von denen viele ins Exil vertrieben wurden, verantwortlich. Der Führer der MAGRIVI, Muhosi Sebulire Karora, wurde am 7. Januar 1997 durch Soldaten der AFDL hingerichtet.
- Maï-Maï. Aus den Rebellenmilizen, welche zu Beginn der 60er Jahre gegen die Zentralgewalt kämpften, hervorgegangen, werden die Maï-Maï-Milizen meist von jungen Männern der autochthonen Ethnien des Nord-Kivu (vor allem Nyanga und Hunde) gebildet. Vorerst den Banyarwanda-Völkern feindlich gesinnt, schlossen sich die Maï-Maï allmählich wiederum den Tutsis an, als die AFDL ihre Offensive im Osten startete. Die disziplinlosen Maï-Maï-Milizionäre sind davon überzeugt, über magische Kräfte zu verfügen. So beziehen sie ihre eigenartigen Übernamen
(= 'Wasser, Wasser') aus einer Art magischer Substanz, welche sie unsterblich machen soll. Mit dieser Tinktur bespritzen sie den Körper, bevor sie den Feind angreifen. Sie machten sich der Gewalt und der Brutalität gegen Zivilpersonen schuldig und wandten sich erneut gegen ihre Verbündeten, die Tutsis, welche beschlossen hatten, sie anfangs 1997 zu entwaffnen.
12.4. Geheimdienste
- ANR - Nationaler Nachrichtendienst (Agence Nationale de Renseignements). Wurde anfangs 1997 als Nachrichtendienst der AFDL geschaffen und wird von Paul Kabongo (vom Kasaï abstammend) geführt. In Kinshasa angekommen, integrierte die ANR die Räumlichkeiten des ehemaligen 'Service National d'Intelligence et de Protection' (SNIP) - seit Dezember 1996 'Direction Générale de la Sûreté Nationale' (DGSN) genannt - das heisst den ehemaligen zivilen Nachrichtendienst unter dem Befehl von Marschall Mobutu.
13. Inhaftierung und Strafvollzug
Unter dem alten Regime wurde die Dauer der Präventionshaft (48 Stunden) bei weitem nicht respektiert. Die Gefangenen wurden meist über lange Zeit ohne Beweis und ohne Urteil festgehalten, und die Hilfe eines Anwaltes wurde ihnen verweigert. Die Haftbedingungen in den verschiedenen Gefängnissen des Landes waren oft sehr schwierig. Am 17. Mai 1997, als die Truppen der AFDL in Kinshasa einmarschierten, belagerte die Bevölkerung die wichtigsten Gefängnisse der Hauptstadt (und des Landes), vor allem das Zentralgefängnis von Makala und das Militärgefängnis von Ndolo und befreite alle Gefangenen. Seit der Machtübernahme durch die AFDL schritten die neuen Behörden zu einer Serie von Säuberungen und Festnahmen, vor allem unter den Direktoren der Staatsunternehmen, den hohen Offizieren der ehemaligen Streit- und Sicherheitskräfte, sowie den hohen Funktionären der ehemaligen Einheitspartei (vgl. MPR). Diese Personen haben Hausarrest oder werden an verschiedenen Orten der Hauptstadt in Haft gehalten, wie beispielsweise im Militärgefängnis von Ndolo, im ehemaligen Generalquartier des SNIP 'Service National d'Intelligence et de Protection' oder dem Militärlager von Kokolo, ja sogar auch in den Hotels von Kinshasa (z.B. im Hotel 'Invest').14. Allgemeine Menschenrechtssituation
Unter dem alten Regime lebte die Bevölkerung wegen Gewalttätigkeiten, Plünderungen und Erpressungen durch die Streitkräfte in dauernd unsicheren Verhältnissen. Mit dem Ausbruch des Bürgerkriegs verschlechterte sich die Situation der Menschenrechte. So plünderten, vergewaltigten und töteten die Soldaten der ehemaligen 'Forces Armées Zaïroises' auf ihrem Rückzug aus dem Osten des Landes, ohne dafür behelligt zu werden, und verbreiteten Schrecken unter den Einwohnern der Städte und Dörfer. Unter diesen Umständen wurden die Tutsis sowie die Staatsangehörigen von Ruanda und Burundi zwischen Oktober und November 1996, vor allem in den Städten Kinshasa und Kisangani, zu Opfern von Machtmissbrauch, Angriffen und Vertreibungen. Diese Übergriffe wurden vor allem von Zivilpersonen begangen, welche durch die Vorzugsbehandlung der ruandischen Flüchtlinge von Seiten der Menschenrechtsorganisationen im Vergleich zur ansässigen Bevölkerung sowie durch eine 'Anti-Tutsi'-Kampagne in Aufruhr waren. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, schritten die Behörden und die Sicherheitskräfte gegen diese Vorfälle nicht ein. Politische Oppositionelle und Menschenrechtsaktivisten, welche diese Missbräuche anzeigten, wurden festgenommen und in Kinshasa inhaftiert. Derartige Verletzungen wurden jedoch nicht ausschliesslich durch die Regierungskräfte begangen. Gemäss Amnesty International 'ist es klar, ... dass sich beide Parteien vorsätzlich zu blinden Angriffen gegen die Zivilbevölkerung hinreissen liessen'. In einem Dokument vom 2. April 1997 stellte der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen fest, dass die Truppen der AFDL verschiedene Massaker gegen die Zivilbevölkerung und die auto0chthonen Milizen, ja selbst gegen ruandische Hutu-Flüchtlinge begangen hatten. Die internationalen Menschenrechtsorganisationen klagten die AFDL-Truppen und ihre Verbündeten (Ugander, Ruander und Burunder) an, die Massaker an Hutu-Ruandern verübt zu haben. Diese Massaker wurden vor allem in den Flüchtlingslagern in den zwei Provinzen des Kivu, in der Nähe der behelfsmässigen Lager zwischen den Städten Kisangani und Ubundu (Ostprovinz), sowie im Umkreis der Stadt Mbandaka (Equateur) begangen. So sind nach Angaben der Vereinten Nationen etwa 200'000 ruandische Hutu-Flüchtlinge in den Wäldern der Demokratischen Republik Kongo verschwunden. Zum Zeitpunkt der Redaktion des vorliegenden Themenpapiers gab es zwischen der UNO und den neuen kongolesischen Behörden übrigens weiterhin starke Unstimmigkeiten; die kongolesischen Behörden werden beschuldigt, die Untersuchungsmission der UNO, welche Licht in die besagten Massaker bringen soll, zu hintertreiben. Die neuen Behörden werden auch von den Menschenrechtsorganisationen kritisiert, und zwar als Folge des am 26. Mai 1997 verfügten Verbots von Demonstrationen und der Suspendierung 'sine die' der Parteien und der politischen Aktivitäten.15. Politische und religiöse Bewegungen
Am 26. Mai 1997, neun Tage nach der Machtübernahme durch die Demokratische Allianz für die Befreiung von Kongo-Zaire (Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre, AFDL), 'suspendierten' die neuen Machthaber bis auf weiteres die Parteien und die politischen Aktivitäten. Nur die AFDL blieb legal. Von dieser Massnahme sind etwa 400 Gruppierungen - ob verzeichnet oder nicht - betroffen; der grösste Teil von ihnen hält es mit einer der drei wichtigsten Parteikoalitionen, welche bis dahin das politische Leben des Landes geprägt hatten, das heisst: Die 'Forces Politiques du Conclave' (FPC, oder 'mouvance présidentielle'), welche den Ex-Präsidenten Mobutu unterstützen, die 'Union Sacrée de l'Opposition Radicale' (USOR), welche die Parteien der radikalen demokratischen Opposition umfasst, sowie die 'Union pour la République et la Démocratie' (URD) - eine Abspaltung der USOR - als Repräsentantin der gemässigten Opposition. Zum Zeitpunkt der Redaktion dieses Informationsblattes war uns nicht bekannt, ob das erwähnte Verbot auch die etwa 500 nicht-staatlichen, gewerkschaftlichen und kulturellen Vereinigungen, die sogenannte 'Société Civile', betraf.15.1. AFDL - Demokratische Allianz (Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération)
Die AFDL, auch bekannt unter der Bezeichnung 'Demokratische Allianz für die Befreiung von Kongo-Zaire' (Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre, AFDL/C-Z) wurde offiziell am 18. Oktober 1996 in Lemera (Süd-Kivu) gegründet. Es handelt sich um eine aus der 'Partei der Volksrevolution' (Parti de la Révolution Populaire, PRP), der 'Demokratischen Volksallianz' (Alliance Démocratique du Peuple, ADP), dem 'Nationalen Rat des Widerstands für die Demokratie' (Conseil National de Résistance pour la Démocratie, CNRD) und der 'Revolutionäre Bewegung für die Befreiung des Kongo-Zaire' (Mouvement révolutionaire pour la libération du Congo-Zaïre, MRL/C-Z) zusammengesetzte Allianz. Laurent-Désiré Kabila (Führer des PRP) ist der Führer der AFDL. Die Führer der 'Allianz' erklären, sie wollten 'ein echtes demokratisches System' errichten, dies mit Hilfe eines 'Wertewandels, was es erlaube, den Leuten gute Sitten beizubringen'. Zu diesem Zweck organisiert die AFDL Seminare, in welchen die Ideologie, die Geschichte und das Vorgehen gelehrt wird, wie Basisausschüsse, wie die 'Quartiervolksausschüsse' (Comités populaires de quartier oder 'Tchembe-Tchembe'), deren Mitglieder bewaffnet sind, auf die Beine gestellt werden.- ADP - Demokratische Volksallianz (Alliance Démocratique du Peuple). Die ADP ist im wesentlichen eine militärische Formation. In ihren Reihen sind etwa 3'000 Tutsi-Soldaten ('Banyamulenge' und 'Banyamasisi') aus Süd-Kivu und Nord-Kivu. Der Führer der ADP, Deogratias Bughera ('Deo' oder 'Douglas' genannt), ist der 'Delegierte' der AFDL für Nord-Kivu.
- CNRD - Nationaler Rat des Widerstandes für die Demokratie (Conseil National de Résistance pour la Démocratie). Aus Kämpfern aus dem Kasaï Oriental zusammengesetzt, welchen sich die nach Angola ausgewanderten Söhne der ehemaligen 'gendarmes katangais' (aus Katanga stammend) angeschlossen haben. Der Führer des CNRD, André Kisasse Ngandu (ein Luba des Kasaï Oriental), welche die Streitkräfte der AFDL führte, wurde am 8. Januar 1997, in einen Hinterhalt gelockt, getötet. Emile Ilunga hat ihn ersetzt.
- MRL/C-Z - Revolutionäre Bewegung für die Befreiung von Kongo-Zaire (Mouvement révolutionnaire pour la Libération du Congo-Zaïre). Das MRL/C-Z basiert praktisch vollständig auf den Bashi, einem in der Umgebung der Stadt Bukavu (Süd-Kivu) lebenden Volk. Der Führer des MRL/C-Z, Masasu Nindaga, ist der 'Delegierte' der AFDL für den Süd-Kivu.
- PRP - Partei der Volksrevolution (Parti de la Révolution Populaire). Eine Gruppe marxistischer Tendenz, 1967, in der Nähe der Stadt Uvira (Süd-Kivu), gegründet (vor allem durch Angehörige der Ethnien Babwari und Banyamulenge). Der Präsident des PRP ist zur Zeit der Staatschef und Führer der AFDL, Laurent-Désiré Kabila (ein Luba aus Shaba). Weitere wichtige Persönlichkeiten des PRP sind zur Zeit der Gouverneur des Katanga, Gaëtan Kakundji (ein Vetter von Kabila) und Joseph Kabila (Sohn des Führers der PRP).
15.2. Der AFDL nahestehende Parteien
Unter den der AFDL nahestehenden Gruppierungen sind insbesondere die folgenden zu nennen:- FLNC - Nationale Befreiungsfront des Kongo (Front de Libération Nationale du Congo). Ist marxistisch ausgerichtet und wurde anfangs der 60er Jahre gegründet. Sie wird von Nathaniel Mbumba geführt und aus Kämpfern aus Katanga ('die Tiger' - les Tigres genannt) gebildet. Sie hatte ihre Stützpunkte lange Zeit in Angola, von wo aus sie an den beiden Kriegen von Shaba (1977 und 1978) teilnahm. Ende 1991, nach der Rückkehr ihrer Angehörigen in das Land, legalisiert, beteiligte sich der FLNC an den Parteien der USOR (radikale Opposition).
- FP - Patriotische Front (Front Patriotique). Ist ebenfalls unter der Bezeichnung 'Patriotische Front für Erneuerung und Fortschritt' (Front Patriotique pour le Renouveau et le Progrès, FPRP) bekannt. Im Mai 1990 gegründet, beteiligte sie sich an den radikalen Parteien (vgl. USOR) und weist zwei verschiedene Strömungen auf. Beide sind jedoch durch ihre diesbezüglichen Führer in der gegenwärtigen kongolesischen Regierung vertreten, das heisst durch Jean-Baptiste Sondji (Minister für Gesundheit und Soziales) und Paul Kinkela Vi Kan'si (Minister für Post und Telekommunikation).
- MNC-L - Nationale kongolesische Lumumba-Bewegung (Mouvement National Congolais-Lumumba). Die MNC-L wurde am 15. Januar 1981 gegründet und wird von François Emery Lumumba geführt. Er kehrte am 17. September 1992 nach 32 Jahren Exil nach Zaire zurück. Die MNC-L ist eine der zahlreichen Bewegungen, welche die Erbschaft der 'Kongolesischen Nationalbewegung' (Mouvement National Congolais, MNC) für sich beanspruchten. Diese Bewegung wurde am 10. Oktober 1958 durch den Nationalhelden Patrice Lumumba (Vater von François), welcher am 17. Januar 1961 ermordet wurde, gegründet.
15.3. USOR - Heilige Union der Radikalen Opposition (Union Sacrée de l'Opposition Radicale)
Die USOR, auch unter der Bezeichnung 'Heilige Union der Radikalen Opposition und Verbündete' (Union Sacrée de l'Opposition Radicale et Alliées, USORAL) bekannt, wurde am 5. Juli 1991 unter dem Namen 'Heilige Union' (Union Sacrée) von den wichtigsten Oppositionsparteien gegründet. Sie wird von Kibassa Maliba (vgl. UDPS) geführt und vereinigt die sogenannten 'radikalen' oppositionellen Gruppierungen in sich. Von den wichtigsten seien folgende erwähnt:- FONUS - Erneuerungskräfte der Heiligen Union (Forces Novatrices de l'Union Sacrée). Die 'Forces Novatrices de l'Union Sacrée', auch bekannt unter der Bezeichnung 'Erneuerungskräfte für die Union und die Solidarität' (Forces Novatrices pour l'Union et la Solidarité), werden von Joseph Olengha Nkoy, einem politischen Oppositionellen, welcher jeden Kompromiss mit dem ehemaligen Regime ablehnte, geführt. Die 'Forces Novatrices' spielen eine Hauptrolle bei der Vorbereitung von Strassenaktionen, wie Kundgebungen und Generalstreiks, allgemein 'Tote Stadt' (ville morte) genannt.
- UDPS - Union für Demokratie und sozialen Fortschritt (Union pour la Démocratie et le Progrès Social). Die UDPS wurde am 15. Februar 1982 von einer Gruppe von 13 dissidenten Parlamentariern gegründet. Sie wird von vier Personen geführt: das heisst Etienne Tshisekedi, Kibassa Maliba, Lihau Ebua und Mbwankiem Nyaroliem. Im März 1996 war sie von einer wichtigen Abspaltung betroffen. Seither gibt es die 'legale' UDPS, geführt vom Präsidenten der USOR, Kibassa Maliba, und die 'orthodoxe' UDPS, geführt von Etienne Tshisekedi. Dieser wurde am 15. August 1992 von der 'Conférence Nationale Souveraine' (CNS) zum Premierminister gewählt und im Februar 1993 durch den Staatschef seines Postens wiederum enthoben. Trotzdem betrachtete sich der Führer der UDPS weiterhin als der einzige Chef der legitimen Regierung, was ihn nicht daran hinderte, am 2. April 1997 eine neue Nomination für den gleichen Posten anzunehmen. Allerdings eine kurzlebige Nomination in Anbetracht der Tatsache, dass sie sechs Tage später widerrufen und von der AFDL, welche ihn beschuldigte, in die Fussstapfen Mobutus getreten zu sein, abgelehnt wurde. Mobutu wurde übrigens von der AFDL bei der Bildung der neuen Regierung nicht berücksichtigt, was seine Anhänger dazu bewog, die Demonstrationen gegen das neue Regime zu verstärken.
15.4. URD - Union für die Republik und die Demokratie (Union pour la République et la Démocratie)
Aus einer Abspaltung von der USOR zwischen April und Mai 1994 hervorgegangen, verkörperte die 'Union pour la République et la Démocratie' (URD) eine gemässigte Strömung innerhalb der Oppositionskoalition. Zu den wichtigsten Formationen der URD gehören:- PDSC - Demokratische und Christlich-soziale Partei (Parti Démocrate et Social-Chrétien). Die PDSC, bestehend aus Katholiken, Protestanten und Kimbanguisten wurde im April 1990 gegründet und verkörpert die christlichen Moralwerte. Sie wurde am 17. Januar 1991 legalisiert und setzt sich aus Persönlichkeiten zusammen, welche zum grössten Teil der ehemaligen Einheitspartei (vgl. MPR) angehörten. Seit dem Tode ihres Gründers Joseph Ileo Nsongo Amba hat sich die Partei in drei Gruppen aufgespalten. Die Hauptgruppe wird von André Boboliko Lokonga präsidiert, welcher ebenfalls erster Vizepräsident des zairischen Parlaments war, das heisst des 'Hohen Rates der Republik - Übergangsparlament' (Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, HCR-PT).
- UDI - Union der Unabhängigen Demokraten (Union des Démocrates Indépendants). Sie wurde im April 1991 gegründet und ist aus ehemaligen Technokraten und Würdenträgern des MPR, unter ihnen der ehemalige Premierminister Léon Kengo Wa Dondo (vom 14. Juni 1994 bis 24. März 1997 im Amt) zusammengesetzt. Hauptsächlich aus wirtschaftlichen Kreisen hervorgegangen, sind die Führer der UDI im Allgemeinen mit grossen persönlichen Gütern ausgestattet.
15.5. FPC - Politische Kräfte der Konklave (Forces Politiques du Conclave)
Die 'Politischen Kräfte der Konklave' (Forces Politiques du Conclave, FPC), auch bekannt unter der Bezeichnung 'präsidiale Bewegung' (mouvance présidentielle), stellen eine informelle Vereinigung von Parteien und Persönlichkeiten dar, welche mit Marschall Mobutu verbunden sind. Unter diesen Parteien sind vor allem zu erwähnen:- FCN - Gemeinsame Front der Nationalisten (Front Commun des Nationalistes). Die FCN wurde am 25. April 1990 von zwei ehemaligen Kadern des MPR, Kamanda Wa und Mandungu Bula Nyati, welche weiterhin mehr oder weniger starke Beziehungen mit der ehemaligen Einheitspartei unterhielten, gegründet. 1993 spaltete sich die Partei unter der jeweiligen Führung der beiden obenerwähnten Persönlichkeiten in zwei Richtungen auf, das heisst in die von FCN-'Kamanda' und von FCN-'Mandungu'.
- MPR - Volksbewegung der Revolution (Mouvement Populaire de la Révolution). Die MPR wurde 1967 als Einheitspartei gegründet, verlor jedoch am 5. Juli 1980 diesen Status. Sie übte jedoch immer einen grossen Einfluss auf den Verwaltungsapparat aus. Der Führer des MPR war Marschall Mobutu. Die laufenden Geschäfte oblagen Banza Mukalay (1. Vizepräsident). Unmittelbar vor der Machtübernahme durch die AFDL flohen mehrere Kader und mit dem MPR verbundene Persönlichkeiten ins Ausland.
- UFERI - Union der Föderalisten und der unabhängigen Republikaner (Union des Fédéralistes et des Républicains Indépendants). Am 6. August 1990 gegründet und am 14. Januar 1991 legalisiert, hat sich die UFERI seither aufgespalten. Die Abteilung 'pro-mobutiste' wird von Jean Nguza Karl-I-Bond (Präsident der FPC) und vom Ex-Gouverneur von Shaba, Gabriel Kyungu Wa Kumwanza, geleitet. Zwischen 1992 und 1993 waren die 'JUFERI'-Milizen (Parteijugend) die Hauptstütze für die Vertreibung von Hunderttausenden von Angehörigen des Luba-Volkes, welche seit Generationen in der Provinz Katanga (Ex-Shaba) niedergelassen waren, in die beiden Provinzen von Kasai. Gegen Mitglieder der UFERI, welche am 14. April 1997 in Lubumbashi gegen die Absetzung des Gouverneurs von Shaba, Kyungu wa Kumwanza demonstrierten und "innerhalb von 48 Stunden" Wahlen verlangten, wurde mit Soldaten der AFDL hart vorgegangen.
15.6. Andere Bewegungen und Organisationen
Nicht zur AFDL, USOR, URD oder den FPC gehören im wesentlichen folgende Gruppierungen:- CRLK - Rat des Widerstandes und der Befreiung für Kivu (Conseil de Résistance et de Libération du Kivu). Der CRLK ist aus Kämpfern der Babembe-Milizen - eine den Tutsis feindlich gesinnte Ethnie - zusammengesetzt und kämpft im Süd-Kivu gegen die AFDL (in der Umgebung von Fizi, Baraka und längs des Uvira-Sees). In dieser Region arbeitet der CRLK mit den burundischen Hutu-Widerstandskämpfern zusammen, welche die 'Kräfte für die Verteidigung der Demokratie' (Forces pour la Défense de la Démocratie, FDD) bilden.
- PALU - Lumumbistische Vereinigte Partei (Parti Lumumbiste Unifié). Die Partei wurde am 22. August 1964 gegründet. Sie wird zum harten Flügel der Opposition gerechnet. Der Generalsekretär der PALU, Antoine Gizenga, kehrte nach 26 Jahren Exil im Februar 1992 in das Land zurück. Die der sozialistischen Strömung verbundenen PALU scheint der AFDL nahezustehen. Die militanten Angehörigen der PALU kritisierten heftig den "Wechsel der Diktatur Mobutu zu derjenigen von Kabila" und organisierten am 25. Juli 1997 offen feindliche Kundgebungen gegen die neuen Machthaber.
15.7. Menschenrechtsorganisationen
In der Demokratischen Republik Kongo sind mehrere Menschenrechtsorganisationen tätig; im folgenden seien die bekanntesten erwähnt:- AZADHO - Zairische Gesellschaft für die Verteidigung der Menschenrechte (Association Zaïroise de Défense des Droits de l'Homme). Die AZADHO wurde am 10. Januar 1991 von einer Gruppe junger Juristen, Mediziner, Politiker und Journalisten gegründet; sie wird von Fürsprecher Guillaume Ngefa Atondoko geführt. Sie sieht sich als eine 'nationale, nicht-staatliche und apolitische Organisation mit dem Hauptziel, die Rechte und Freiheiten des Einzelnen und des Kollektivs zu verteidigen und zu wahren'. Die AZADHO, die Berichte veröffentlichte, in welchen sie auf Machtmissbrauch und Menschenrechtsverletzungen durch die neuen Machthaber hinwies, war bereits vom ehemaligen Regime nicht gern gesehen, und wird nun vor allem von den Angehörigen der AFDL beschuldigt, sie stehe im Dienst der alten Machthaber.
- CADDHOM - Gemeinsame Aktion für die Entwicklung der Menschenrechte (Collectif d'Action pour le Développement des Droits de l'Homme). Im Osten des Landes verwurzelt, waren die Mitglieder der CADDHOM wiederholt Opfer von Einschüchterungshandlungen von Seiten der Sicherheitskräfte des alten Regimes. Mehrere ihrer Mitglieder, welche versuchten, Nachforschungen über die der Zivilbevölkerung und vor allem die den Tutsis zugefügten Gewalttätigkeiten anzustellen, wurden wiederholt festgenommen.
- CDDH - Komitee für die Demokratie und die Menschenrechte (Comité pour la Démocratie et les Droits de l'Homme). Eine Organisation, welche der 'Union für Demokratie und sozialen Fortschritt' (Union pour la Démocratie et le Progrès social, UDPS) von Tshisekedi nahesteht. Das CDDH ist vor allem in Kinshasa aktiv.
- CDHM - Komitee für Menschenrechte jetzt (Comité des Droits de l'Homme maintenant). Es handelt sich um eine Plattform, welche die wichtigsten Menschenrechtsorganisationen (AZADHO, VSV, CDDH, usw.) vereinigt.
- VSV - Stimme derjenigen, welche keine Stimme haben (Voix des sans Voix). Diese wurde in den 80er Jahren gegründet und gab am 24. April 1990 ihre Geheimhaltung auf; sie wird von Floribert Chebeya Bahizire geleitet. Die Kader der VSV, welche sich nach den Haftbedingungen der Gefangenen ruandischer Herkunft erkundigten, wurden zwischen dem 28. Oktober und dem 2. November 1996 in Kinshasa verhaftet. Wie die AZADHO ist die VSV von den neuen Machthabern ungern gesehen, und zwar auf Grund besonders kritischer Berichte, welche die von Angehörigen der AFDL begangenen Machtmissbräuche anprangern.
15.8. Gewerkschaften
Unter den zahlreichen Gewerkschaften sind zwei zu erwähnen:- COSSEP - Rat der Gewerkschaften der öffentlichen Dienste (Conseil de Syndicats des Services Publics). Plattform, welche die wichtigsten Gewerkschaften mit öffentlichen Funktionen in sich vereinigt, worunter vor allem die 'Nationale Direktion der Staatsangestellten und Beamten' (Direction nationale des Agents et Fonctionnaires de l'Etat, DINAFET) und das 'Nationale Komitee der Amtsinhaber und Staatsbeamten' (Comité National des Mandataires et Fonctionnaires de l'Etat, CONAFAMET).
- UNTZa - Nationale Arbeiterunion Zaire (Union Nationale des Travailleurs du Zaïre). Die UNTZa wurde 1967 als Satellit des MPR gegründet und war lange Zeit die einzige von den Machthabern anerkannte Gewerkschaft. Als sie Mitte 1990 dieses Monopol verlor, sprangen viele Mitglieder ab.
Karte der Demokratischen Republik Kongo Quelle: Egunduka, G. et Ngobasu, E.: Volonté de changement au Zaïre. Vol 1. L'Harmattan. Paris. 1991, S. 18 (modifiziert)