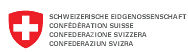Sudan - Länderinformationsblätter
| Publisher | Switzerland: State Secretariat for Migration (SEM) |
| Publication Date | 27 October 1994 |
| Cite as | Switzerland: State Secretariat for Migration (SEM), Sudan - Länderinformationsblätter, 27 October 1994, available at: https://www.refworld.org/docid/4670e9412.html [accessed 8 June 2023] |
| Disclaimer | This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States. |
1. Verfassung
1.1. Staatsname
Demokratische Republik Sudan Jamhuriyat As-Sudan1.2. Staatsform
Seit dem Militärputsch vom 30. Juni 1989 durch Generalleutnant Omar Hassan Ahmad Al-Bashir ist die Übergangsverfassung von 1985 ausser Kraft gesetzt. Formell bleibt Sudan eine Republik, die seit Mai 1991 eine föderative Struktur besitzt.2. Soziales und Kultur
2.1. Bevölkerung
Einwohner: 27,4 Mio. (Schätzung von 1993) Städte: Hauptstadt: Khartoum (500'000). Khartoum bildet mit den zwei Städten Omdurman (500'000) und Khartoum-Bahri (Khartoum-Nord) (340'000) ein grosses Zentrum, wo schätzungsweise 3 Millionen Menschen leben, also doppelt so viele wie die offiziellen Angaben. Weitere Grossstädte: Port Sudan (210'000), Wad Medani (140'000), Al-Obeid (140'000) Bevölkerungsstruktur: mehr als 45 % sind jünger als 15 Jahre Lebenserwartung: 49 Jahre Analphabeten: 73 % Ethnien: 19 Ethnien mit 597 Untergruppen: Araber 40 %, Südsudanesen 30 %, darunter Niloten (Nuer, Dinka, Schilluki, Jur, Annak; alle Viehzüchter), nomadisierende Nilo-hamiten und Sudaniden (Azande, Moru; vorwiegend Ackerbauern), sudanesische Schwarzafrikaner (Fur, Nuba), Nubier 10 %, Beja 7 %.2.2. Sprache
Staatssprache ist Arabisch. Wichtigste Handelssprache ist Englisch. Viele Völker sprechen ihre eigene Sprache, z.B. Bari, Dinka, Kreish, Latuka, Moru, Ndogo, Nuer, Shilluk, Zande.2.3. Religion
Der Islam ist Staatsreligion, ihm gehören etwa 80 % der Bevölkerung an. Die hauptsächlich im Norden lebenden Muslime sind in ausgeprägter Weise in verschiedenen Sekten (Tariqas) organisiert. Die bekanntesten sind die Khatmiya-Sekte, die in Kassala ihr Zentrum hat, sowie die Ansar-Sekte und die Muslim-Bruderschaft. Im Norden gibt es eine Minderheit koptischer und Griechisch-Orthodoxen Christen (vor allem Nubier). Im Süden leben vor allem Christen und Anhänger von Naturreligionen.2.4. Schul- und Bildungswesen
Der Schulbesuch ist im Sudan gratis. Seit ca. 1991 ist in allen Schulen Arabisch die Unterrichtssprache. Von 7-12 gehen die Kinder in die Primarschule, dann für drei Jahre (13-15) in die Mittelschule (intermediate oder Junior secondary). Danach kann man drei oder vier Jahre in die Oberschule (Secondary oder Senior Secondary). Beiden Oberschulen gibt es drei Richtungen; die gewöhnliche Oberschule, die berufsbildende Oberschule und die lehrerbildende Oberschule. Während noch rund 40-60 % der Kinder die Primarschule besuchen, so sind es in der Sekundarschule noch ca. 20 %. Auf dem Land sind es weit weniger Schüler als hier angegeben, während in den Städten der Schulbesuch schon üblich ist. Wer eine Sekundarschule mit einem genügenden Notendurchschnitt im Examen (Sudan Higher School Certificate) abgeschlossen hat, darf eine Universität besuchen. Seit 1994 muss jede Frau und jeder Mann vor dem Studium auch eine dreimonatige paramilitärische Ausbildung bei den PDF (siehe Kapitel 11.) absolviert haben. Es gibt fünf Universitäten: in Khartoum, Juba, Gezira und Wadi Medani und die islamische Universität in Omdurman. Weitere Universitäten sind geplant in den Regionen Oberer Nil und Bahr Al-Ghazal.2.5. Medizinische Infrastruktur
Die medizinische Grundversorgung ist durch den langanhaltenden Bürgerkrieg erheblich beeinträchtigt worden. Unzureichende Hygiene und mangelnde Nahrungsversorgung sind vor allem auf dem Land weitverbreitet. Sauberes Trinkwasser und sanitäre Einrichten gibt es ausserhalb der Städte kaum. Cholera und Meningitis-Epidemien fordern im Süden regelmässig ihre Opfer. Auch die Malaria ist weitverbreitet. Es herrscht ein akuter Mangel an Ärzten, besonders krass ist das Beispiel der Region Darfur im Jahre 1984 (keine neueren Zahlen verfügbar), wo ein Zahnarzt 3 Millionen Einwohner zu versorgen sollte.3. Medien
Die Pressefreiheit ist im Sudan sehr beschränkt. Seit dem Putsch von 1989 gibt es nur noch staatliche Zeitungen. Ein Zensurorgan (Censor Board) kontrolliert sämtliche nationalen Zeitungen, Zeitschriften, Radio- und Fernsehsendungen. Auch die ausländischen Publikationen werden vor ihrer Veröffentlichung zensuriert. Im Juni 1993 verkündete die Regierung, dass nunmehr auch freie Zeitungen erlaubt seien. Seither haben sind einige neue Zeitungen im Sudan aufgetaucht, z.B. Al-Sudani Al-Doulia, die vorher in Beirut produziert worden ist. Diese unabhängigen Zeitungen werden genauestens überwacht, eine neue Zeitung (Al-Sudani International) ist bereits wieder verboten.Tageszeitungen:
Al-Engaz Al-Watan, Khartoum
As-Sudan Al-Hadeeth, Khartoum
Al-Sudani Al-Doulia, Khartoum (im April 1994 verboten)
Zeitschriften:
Al-Guwwat Al-Musallaha (Die Armee), Khartoum, wöchentlich, Arabisch
Presseagentur:
Sudan News Agency (SUNA)
Khartoum Sudanese Press Agency
Radio:
Sudan Broadcasting Service, Omdurman, Amharisch, Arabisch, Englisch, Französisch, Somali, Tigriniya
Fernsehen:
Sudan National Television Corporation, Omdurman, sendet 60 Stunden wöchentlich.
4. Wirtschaft
4.1. Volkswirtschaft
Der Sudan hat hauptsächlich eine Agrarlandwirtschaft, auch wenn nur ein sehr kleiner Teil des fruchtbaren Landes auch bebaut wird. Etwa 60 % der gesamten Bevölkerung ist in der Landwirtschaft tätig, die Mehrheit von ihnen produziert ausschliesslich für den Eigenbedarf. Agrarprodukte machen etwa 95 % der gesamten Exporte aus, davon die langfaserige Baumwolle 40 % und Gummiarabicum etwa 20 %. Ende der 70-er Jahre werden in der Region Süd-Kordofan Ölvorkommen gefunden, deren Förderung jedoch aufgrund des Bürgerkrieges noch nicht aufgenommen worden sind. Im Februar 1992 erhielt die kanadische International Petroleum Corporation (IPC) die Erlaubnis, das Öl am Roten Meer im Halaib-Dreieck zu fördern, was zu einem diplomatischen Konflikt mit Ägypten führte. Die sudanesische Wirtschaft ist in äusserst schlechter Verfassung. Dürre, Bürgerkrieg, hohe Auslandschulden, Haushaltsdefizit, eine Inflation von derzeit jährlich (geschätzten) ca. 200 % führten dazu, dass der IWF den Sudan zum Non Cooperative Member erklärte. Dazu kam, dass der Sudan während des Golfkrieges eine pro-irakische Haltung einnahm, so dass viele internationale Geldgeber keine Kredite gewährten. Über die Beschäftigungssituation im Sudan gibt es keine verlässlichen Zahlen, Mitte der 80er Jahre gab es ca. 12 % Arbeitslose. Viele Sudanesen arbeiten als Gastarbeiter in den Golfstaaten. Um die Preiserhöhungen etwas abzufedern, ist 1992 der Mindestlohn auf 1'500 sudanesische Pfund erhöht (ca. 70 CHF) worden.4.2. Währung
Währung ist das Sudanesische Pfund (S£), auch "Gineh" genannt. Ein S£ wird in 100 Piaster oder "Kurusch" unterteilt. Es gibt Münzen zu 1, 2, 5, 10 und 50 Piaster sowie Noten zu 25 und 50 Piaster und 1, 5, 10, 20, 50 und 100 S£. Im Mai 1992 ist das Sudanesische Pfund offiziell durch den Sudanesischen Dinar ersetzt worden. Es handelt sich jedoch nicht wirklich um eine neue Währung, sondern um eine neue Einheit der alten Währung (10 S£ = 1 SD). Das Sudanesische Pfund bleibt bis auf weiteres das gebräuchliche Zahlungsmittel. Im Mai 1994 gilt ein Devisenkurs von: 1 CHF = 218.34 S£ (1 CHF = 21.834 SD) 100 S£ = 0.458 CHF (100 SD = 4.58 CHF)5. Mobilität
5.1. Kommunikationsmittel
Die angenehmste Art, sich innerhalb des Sudans zu bewegen, ist per Flugzeug. Sudan Air bedient von Khartoum aus mit zwölfsitzigen Propellermaschinen mehrere Städte wie Wadi Halfa, Karima, Al-Obeid, Nyala, Al-Fasher und Juba. Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Flugplätze und Landepisten. Der Sudan verfügt über ein Eisenbahnnetz, welches von Khartoum aus sternförmig in die Städte Nyala (Darfur), Wau (Bahr Al-Ghazal), Er Roseires (Blauer Nil), Port Sudan (Rotes Meer) und Wadi Halfa (Nord) führt. Die Zugfahrt 2. Klasse Khartoum-Wadi Halfa (ca. 800 km) kostete 1992 noch 90 S£ (= 1 CHF), die Reise dauert zwischen zwei und fünf Tagen, der Zug fährt einige wenige Male pro Monat. Die grösseren Städte entlang der geteerten Strassen sind auch mit Bussen und Lkws miteinander verbunden. Während die Busse noch einen akzeptablen Standard haben, so nimmt man auf den Bedford-LKW (lorries) auf der Ladefläche Platz.5.2. Reisepapiere
Im Prinzip kann sich jedermann innerhalb des Sudans frei bewegen. An den Ausfallstrassen um Khartoum sind jedoch zahlreiche Verkehrskontrollen, wo die Polizei verbotene Waren und gesuchte Personen aufzuspüren sucht. Jedermann muss seine ID auf sich zu tragen. In Khartoum galt vom 1. November 1989 bis zum 30. Oktober 1993 eine Ausgangssperre für die Zeit von 24.00 - 4.00 Uhr. Für eine legale Ausreise muss ein Sudanese einen Pass und ein Ausreisevisum beantragen. Damit er einen solchen erhält, benötigt er einen Nationalitätsausweis (mit grünem Stoffumschlag), der wiederum nur mit Hilfe eines Unbescholtenheitszeugnis (ähnlich dem Leumundszeugnis in der CH) erhältlich ist. Das Ausreisevisum wird durch das Ministerium für Innere Angelegenheiten, (Büro für Pässe, Immigration und Nationalität) erteilt. Ein Ausreisevisum ist in aller Regel durch den Sicherheitsdienst genehmigt.6. Regierung
6.1. Staatsoberhaupt
Staatspräsident und Regierungschef ist Generalleutnant Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, der seit dem 16.10.1993 alleiniges Staatsoberhaupt ist.6.2. Landesregierung
Ein neun-köpfiger Revolutions-Kommandorat Revolutionary Command Council for National Salvation (RCC) regierte das Land seit dem Militärputsch vom 30. Juni 1989 bis am 16. Oktober 1993 unter dem Vorsitz des Präsidenten Generalleutnant Omar Hassan Ahmad Al-Bashir. Der RCC übte die legislative und exekutive Gewalt aus. Seitdem 16. Oktober 1993 sind alle Vollmachten des RCC auf den Präsidenten Al-Bashir übergegangen.7. Parlament
Das Parlament wird nach dem Putsch vom 30. Juni 1989 aufgelöst. Im Februar 1992 hat Präsident Al-Bashir ein Übergangsparlament (National Assembly) mit 300 persönlich von Al-Bashir ausgesuchten Mitgliedern eingesetzt, welches Parlamentswahlen für den Juni 1994 vorbereiten soll. Diese Wahlen haben bis zum Zeitpunkt der Redaktion dieser Zeilen (Juli 1994) noch nicht stattgefunden. Das Übergangsparlament hat ein Vetorecht für alle vom RCC verabschiedeten Gesetze.8. Verwaltung
Im März 1991 hat der Sudan eine föderative Struktur erhalten, mit neun Bundesstaaten (Regionen), 66 Provinzen und 281 Gemeinden. Nord (Ash Shamaliyah)Ost (Ash Sharqi)
Khartoum
Darfur
Kordofan
Zentral (Al-Awsat)
Bahr Al-Ghazal
Oberer Nil (A'Ali An Nil)
Equatoria (Al-Istiwaiya) Im Februar 1994 werden 17 neue Regionen geschaffen, die weitgehend der bisher gebräuchlichen Einteilung in Teilregionen entspricht. Neu dabei ist die formelle Bezeichnung der 26 Regionen inklusive ihrer Gouverneure und der Regionalregierungen. Die 26 Regionen sind: Al-Gezira
Al-Qadarif
Al-Buhayrat
Bahr Al-Jabal
Blue Nile
Jonglei
Kassala
Khartoum
Nile
Nord
Nord Bahr Al-Ghazal
Nord Darfur
Nord Kordofan
Oberer Nil
Ost Equatoria
Red Sea
Sinnar
Süd Darfur
Süd Kordofan
Unity
Warab
West Bahr Al-Ghazal
West Darfur
West Equatoria
West Kordofan
White Nile Die genauen Grenzen der neuen Verwaltungsregionen sind derzeit noch nicht bekannt, deshalb wird hier auf eine Karte verzichtet.
9. Wahlen
Es gibt derzeit im Sudan keine durch allgemeine Wahlen bestimmten staatlichen Organe. Im April 1986 haben die letzten Parlamentswahlen im Sudan stattgefunden. In mehreren Gebieten im Süden haben dabei keine Wahlen durchgeführt werden können wegen des Bürgerkrieges. Bei diesen Wahlen hat die Partei Umma von Sadiq Al-Mahdi 99 Sitze erreicht, die DUP von Osman Al-Mirghani 63 Sitze und die islamische NIF von Hassan Al-Turabi 51 Sitze. Damit hat die Koalition Umma - DUP eine Mehrheit von 162 der 264 Sitze gewonnen. Dieses Parlament ist bei dem Putsch vom 30. Juni 1989 aufgelöst worden.10. Gerichtswesen
Scharia:
Die Verfassung von 1973 bezeichnet in Artikel 9 die Scharia und auch das Gewohnheitsrecht als Hauptquellen der Gesetzgebung. Bis 1983 galt hauptsächlich ein auf dem britischen Rechtssystem basierendes Zivilrecht, mit Ausnahme von Ehe- und Erbrecht. Dem wachsenden Druck von islamischen Gruppen wie der Muslim-Bruderschaft wird 1983 stattgegeben, als Präsident Numeiri alle bisher gültigen Gesetze per Dekret durch die Scharia (Septembergesetze) ersetzt. Ebenso ernannte er neue Richter, viele von ihnen gehörten zur Muslim-Bruderschaft. Nach dem Sturz von Präsident Numeiri 1985 sollte die Scharia wieder abgeschafft werden. Eine endgültige Aufhebung der Scharia wird durch den erneuten Putsch im Juni 1989 verhindert. Seitdem ist die Scharia wieder eingeführt und seit März 1991 in einem neuen Strafgesetz kodifiziert. Dieses Strafgesetz gilt auch für den Südsudan, wo das neue Gesetz wie bereits die Septembergesetze von 1983 auf grossen Widerstand stösst und den Konflikt im Südsudan weiter verschärft hat.Ordentliche Gerichte:
Die ordentliche Gerichtsbarkeit ist in vier Stufen aufgeteilt. Die Richter werden durch den Staatspräsidenten auf Vorschlag des Obersten Richters ernannt. Der Oberste Richter kann Sondergerichte einsetzen und er kann den ordentlichen Gerichten Weisungen erteilen. Erste Instanz: Die District Courts für leichte Vergehen und zivilrechtliche Verfahren und die Magistrate Court für leichte strafrechtliche Verfahren bilden die erste Instanz.
Zweite Instanz: Bei einer Berufung gegen ein erstinstanzliches Urteil entscheidet ein General Court, welches seinerseits die erste Instanz bei schweren Vergehen wie Mord, Raubüberfall und Ehebruch ist. Der Vorsitzende eines General Court ist ein Provinz Judge.
Dritte Instanz: Gegen das Urteil eines General Court kann beim Court of Appeal des betreffenden Bundesstaates Berufung eingelegt werden. Es existieren neun Court of Appeal.
Vierte und letzte Instanz: Als letzte Berufungsinstanz fungiert der Supreme Court, welcher aus 35 männlichen Richtern, zwei davon Christen, besteht. Das Oberste Gericht kann auch in erster Instanz urteilen, wenn dies seiner Meinung nach erforderlich ist.
Sondergerichte:
Price and Public Order Courts (= Special Security Courts): Die Price and Public Order Courts, welche die Revolutionären Schutzgerichte (Mahâkim Al-Amn At-thawrîya) von 1989 ersetzen, sind gemäss dem Special Courts Act von 1989 geschaffen worden. Sie bestehen aus drei Personen, meist Offiziere oder auch andere "kompetente" Personen. Sie werden meist aus den Reihen der NIF-Anhänger rekrutiert. Diese Gerichte urteilen über Vergehen gegen Dekrete, Ausnahmezustandsbestimmungen, Teile des Strafgesetzes (wie z.B. Drogendelikte oder Devisenvergehen). Diese Gerichte sind bekannt für ihre harten Strafen. Die Strafen werden sofort ausgeführt mit Ausnahme der Todesstrafe, die vom Obersten Richter (Jallal Ali Lufti) und Staatspräsidenten (Omar Hassan Al-Bashir) bestätigt werden muss.
Town and Rural Courts: Die Town and Rural Courts bestehen gemäss dem Civil Transaction Act von 1983. In diesen Gerichten urteilt eine angesehene Persönlichkeit - ein Häuptling oder ein Scheich - über zivile und strafrechtliche Angelegenheiten nach Gewohnheitsrecht.
Military Courts: Die Militärgerichte urteilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit über Vergehen von Armeeangehörigen.
11. Militär und Sicherheitsorgane
Armee:
Im Sudan besteht für alle Frauen und Männer von 18-33 eine allgemeine Dienstpflicht aufgrund des Nationalen Wehrdienstgesetzes von 1992. Der nationale Wehrdienst kann in verschiedener Form geleistet werden. Jeder Wehrdienstpflichtige kann bei der Armee, Polizei, bei den Ordnungsdiensten, in der Administration oder in Entwicklungsprojekten seinen 24 Monate dauernden Dienst tun. Für Studenten beträgt die Dienstzeit 12 Monate und für Schüler mit einem Sudan Higher School Certificate 18 Monate. Ausgenommen die Angehörigen der (Berufs-)Armee, der Polizei und der Ordnungsdienste, welche nicht wehrpflichtig sind. Studenten, Familienernährern sowie wichtigen Funktionären kann eine Rückstellung gewährt werden. Der Vollzug dieses Gesetzes ist recht lückenhaft. Als die Jahrgänge 1964-1972 im Jahr 1992 über Radio und Fernsehen aufgefordert worden sind, sich zur Einberufung zu melden, haben dieser Aufforderung nur wenige Folge geleistet. Wer sich der Wehrdienstpflicht entzieht, kann mit einer Haftstrafe von 2 bis 3 Jahren bestraft werden. Ob gegen die zahlreichen Wehrdienstverweigerer Strafverfahren eingeleitet worden sind, ist nicht bekannt.Popular Defence Force (PDF):
Die PDF wurden gegründet aufgrund des Popular Defence Force Act vom November 1989. Es handelt sich um eine staatliche Miliz, die hauptsächlich aus NIF-Anhängern besteht. Auch Mitglieder von Milizen einiger Stämme (z.B. der Misseria, Fertit, Taposa, Ruzeigat), die gegen die Dinka-dominierte SPLA kämpfen, sind in die PDF eingetreten. Für Studenten und staatliche Angestellte - sowohl Frauen als auch Männer - ist es Pflicht, eine dreimonatige Ausbildung in der PDF zu absolvieren. Die PDF führt einen heiligen Krieg im Süden, wo sie offiziell die Armee unterstützt. Nach unbestätigten Berichten soll die PDF aber auch Oppositionelle Kräfte innerhalb der Armee überwachen. Weil die Mitglieder der PDF militärisch meist schlecht ausgebildet sind, aber auch aufgrund des Misstrauens vieler Armeeoffiziere ist die Zusammenarbeit zwischen Armee und PDF eher problematisch.Polizei:
Die reguläre Polizei übernimmt viele Sonderaufgaben, wie etwa die Aufsicht in Haftzentren oder den Eigentumsschutz.Volkspolizei:
Die Volkspolizei (People's Police Force, PPF) wurde im Oktober 1992 gegründet, weil die reguläre Polizei angeblich ihrer Aufgabe nicht ausreichend hat erfüllen können. Die Volkspolizei steht der Polizei zur Seite und überwacht zudem noch die Einhaltung der islamischen Verhaltensvorschriften. Als Leiter der PPF werden Anhänger der islamisch-fundamentalistischen NIF rekrutiert. Die PPF ist befugt, Personen zu verhaften und auch Fahndungen durchzuführen.12. Allgemeine Menschenrechtssituation
Bürgerkrieg
Seit 1983, der Einführung der Scharia durch Präsident Numeiri tobt im Sudan der zweite Bürgerkrieg zwischen den Regierungstruppen des muslimischen Nordens und den verschiedenen Fraktionen der Sudanese People's Liberation Army (SPLA) aus dem vorwiegend christlichen Süden. Im Süden lebten 1983 ca. 7 Millionen Menschen, neuere Zahlen sind nicht verfügbar wegen der grossen Zahl geflohenen und umgesiedelten Personen. Gemäss Angaben der UNO mussten mehr 5 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen, mehr als 500'000 befinden sich in Nachbarstaaten, die meisten jedoch innerhalb des Sudans, etwa 3 Millionen Menschen sind gezwungen gewesen, in den Norden zu ziehen, wo sie in Flüchtlingslagern unter schwierigen Bedingung leben müssen. Im sudanesischen Bürgerkrieg geht es nicht alleine nur um die Frage der Einführung der Scharia, es ist auch ein Machtkampf zwischen verschiedenen Sprachgruppen, ein Kampf um die versprochene Autonomie für die südlichen Provinzen, ein Kampf um die Erhaltung der gänzlich anderen Kultur der verschiedenen südlichen nilotischen Ethnien und nicht zuletzt ein Kampf um die fruchtbaren Gebiete des Oberen Nils, wo die Täler regelmässig überschwemmt werden und wo verschiedene Rohstoffe vorhanden sind. Im Zusammenhang mit diesem Bürgerkrieg werden zahlreiche Menschenrechtsverletzungen begangen. Die umgesiedelten Menschen aus dem Süden sind im Norden des Sudan verschiedenen Nachteilen ausgesetzt, so sind 1992 nach Schätzungen von Africa Watch die Häuser von 500'000 meist aus dem Süden stammenden Sudanesen zerstört worden und diese Personen darauf in Flüchtlingslagern ausserhalb der Städte angesiedelt. Ebenso können diese meist nicht-muslimischen Südsudanesen gemäss dem sudanesischen Strafrecht in vielen Fällen härter bestraft werden als ihre muslimischen Mitbürger. Allgemein herrscht ein Druck zur Islamisierung, der sich etwa in der Behinderung der religiösen Aktivitäten und in der wirtschaftlichen Benachteiligung von Nicht-Muslimen äussert. In den Kriegsgebieten kommt es in den vergangen Monaten vermehrt zu krassen Menschenrechtsverletzungen, die von Amnesty International als "ethnische Säuberung" bezeichnet werden. In den Nuba-Bergen in der Provinz Süd-Kordofan im Zentrum des Landes etwa werden die Nuba, ein Volk von etwa 1 Million Menschen, durch Armee, Paramilitärische Miliz (Popular Defence Forces, PDF) und SPLA aus ihrem Gebiet vertrieben. Dabei sollen Anfang 1993 auch mehrere hundert Zivilisten getötet worden sein. Die Menschenrechtsverletzungen werden allen beteiligten Parteien angelastet. Die Stadt Juba im Süden des Landes wird bei einem Angriff der SPLA im Juni 1992 schwer zerstört und bei den Kämpfen kamen mehrere hundert Zivilisten ums Leben.Repression der Opposition
Die sudanesische Regierung begeht auch ausserhalb des Bürgerkrieges viele Menschenrechtsverletzungen. Die Repression trifft vor allem Intellektuelle, Studenten, Parteimitglieder (seit dem Putsch vom 30. Juni 1989 sind sämtliche Parteien verboten), Journalisten, Angehörige der Ethnien Dinka, Fur, Nuba sowie vermeintliche Anhänger der SPLA. Das sudanesische Strafgesetz kennt weder Bestimmungen bezüglich Haftdauer noch formale Bedingungen für eine U-Haft. Deshalb sind Festnahmen ohne Begründung und Inhaftierungen ohne Anklage sehr häufig. Viele Personen verschwinden auch in den geheimen Haftzentren (Ghost Houses), deren Existenz von der Regierung verneint wird, wo sie meist gefoltert und misshandelt werden. In den vergangenen Monaten sind bekannte Politiker (der ehemalige Premierminister und Führer der Umma-Partei Sadiq Al-Mahdi) und andere Persönlichkeiten (z.B. Pfarrer D. Tombe) ebenso Opfer solcher willkürlicher Festnahmen geworden wie viele andere, deren Namen nicht bekannt sind. Sämtliche Parteien sind verboten und alle anderen öffentlichen Bereiche sind unter der Kontrolle der Regierung und der ihr nahestehenden NIF. Viele ehemalige führende Beamte in der gesamten Administration wurden durch NIF-Anhänger ersetzt. Unter den Richtern finden sich keine Oppositionellen mehr, da alle Richter des Landes von der Regierung eingesetzt werden. Ebenso besteht in den Schulen und Universitäten die Tendenz, NIF-treue Personen als Lehrer und Professoren einzusetzen. Jegliche Kritik an der Regierung wird genauestens registriert - auch im Ausland - und unterdrückt. Eine freie sudanesische Presse gibt es nicht, und auch die ausländischen Publikationen werden vor dem Verkauf zensuriert. Nur von der Regierung organisierte Demonstrationen sind erlaubt, in allen Fällen, wo nicht-bewilligte Demonstrationen stattgefunden haben, sind die Sicherheitskräfte mit äusserster Härte eingeschritten.13. Politische und religiöse Bewegungen
Seit dem Militärputsch vom 30. Juni 1989 sind alle Parteien verboten. Die wichtigsten Parteien vor diesem Verbot waren: CPS, Communist Party of Sudan (Al-Hizb Al-Shu'yu'i Al-Sudani). Die CPS geht auf die kommunistische Bewegung Sudan Movement for National Liberation zurück, die 1946 gegründet worden ist. Die CPS hat vor allem Anhänger unter den Intellektuellen, Studenten und Gewerkschaftern, sowie unter den Bahnarbeitern. Nach dem Putschversuch von 1971 wird die CPS verboten und ihre Mitglieder werden vom Numeiri-Regime unterdrückt.
DUP, Democratic Unionist Party (Al-Hizb Al-Dimuqratiyah Al-Ittihadi). Ende der 60er Jahre wird die DUP gegründet durch den Zusammenschluss der National Union Party (NUP) und der People's Democratic Party (PDP). Die DUP hat findet ihre Anhänger vor bei den Mitgliedern der islamischen Khatmiya-Sekte. Die Familie des Führers der DUP, Mohammed Osman Al-Mirghani stellt traditionell jeweils den Führer der Khatmiya-Sekte.
Muslim-Bruderschaft, (Ikhwan Al-Muslimin). Die Muslim-Bruderschaft wird 1928 in Ägypten gegründet und eröffnet 1950 eine Tochterpartei im Sudan. Die Muslim-Bruderschaft ist eine islamisch-fundamentalistische Organisation, welche die Schaffung eines islamischen Staates fordert. Ihr ehemaliger Führer, Hassan Al-Turabi ist von 1969-1977 ohne Gerichtsverfahren inhaftiert gewesen, wird nach seiner Freilassung 1979 zum Generalstaatsanwalt ernannt. Die Muslim-Bruderschaft hat die Einführung der Scharia im September 1983 stark unterstützt. Heute wird die Muslim-Bruderschaft von Habir Nur Ad-Din geführt.
NIF, National Islamic Front (Al-Jabha Al-Islâmiya Al-Qawmîya). Die islamisch-fundamentalistische Nationalfront NIF findet ihren Ursprung in den 40er Jahren in Kairo (Ägypten) im Milieu der Muslim-Bruderschaft. Die NIF wird 1985 durch Hassan Al-Turabi gegründet, der später auch Justiz- und Aussenminister in der Regierung seines Schwagers, Sadiq Al-Mahdi gewesen ist. Die NIF hat seit dem Putsch im Juni 1989 in vielen wichtigen Posten der Regierung ihre Anhänger, so sind Innen-, Finanz-, und Präsidialminister Anhänger der NIF. Auch die Popular Defence Forces (PDF) werden durch die NIF ausgebildet.
Ebenso sind viele Richter und Universitätsprofessoren NIF-Mitglieder. Manche Beobachter munkeln gar, dass nicht Präsident Omar Hassan Al-Bashir das Land regiert, sondern der Führer der NIF, Hassan Al-Turabi, auch wenn dieser keinerlei öffentliches Amt bekleidet. SPLM/SPLA, Sudanese People's Liberation Movement / Sudanese People's Liberation Army. Die SPLM/SPLA wird 1983 unmittelbar nach der Einführung der Septembergesetze gegründet. Die SPLM ist der politische Flügel und die SPLA unter der Führung von John Garang ist der militärische Flügel der Organisation. Die SPLM/SPLA kämpft für eine Autonomie des Südsudan, also der Bundesstaaten Bahr Al-Ghazal, Oberer Nil und Equatoria. Die SPLA ist seit August 1991 in zwei Fraktionen gespalten, die Torit-Fraktion von John Garang, die hauptsächlich aus Dinka besteht und die Nasir-Fraktion von Riak Machar und Lam Akol, die hauptsächlich aus Nuer besteht.
SSU, Sudan Socialist Union (Al-Ittihad Al-Ishtiraki Al-Sudani). Die SSU wird 1971 nach einem Putschversuch durch kommunistische Kräfte gegründet. Die Verfassung von 1973 erklärt die SSU zur einzigen legalen Partei bis sie im April 1985 durch den Militärrat verboten wird.
Umma. Die Umma-Partei ist zusammen mit der Demokratischen Einheitspartei (DUP) die wichtigste Partei im Sudan (vor dem Militärputsch im Juni 1989) gewesen. Ihr Präsident, Sadiq Al-Mahdi, ist von 1986 bis 1989 Ministerpräsident gewesen. Die Umma-Partei ist das politische Organ der Ansar-Sekte, einer konservativen, islamischen Sekte, die ihre Anhänger hauptsächlich unter den Nomaden im Zentrum des Sudan hat. Seit dem Putsch im Juni 1989 werden immer wieder Mitglieder der Umma-Partei festgenommen, so auch Sadiq Al-Mahdi selbst im März 1993. Die Ansar-Sekte unterstützt die Rebellen der SPLA, wenngleich sie entgegengesetzte Ziele verfolgt. Während die SPLA hauptsächlich von Christen unterstützt wird und gegen die Einführung der Scharia im Südsudan kämpft, versucht die Ansar-Sekte durch einen "heiligen Krieg" die Auflösung der Scharia zu verhindern.
Kleinere bekannte Parteien waren: Baath, Beja Congress, National Alliance for Salvation, National Congress Party, National Unionist Party (NUP), People's Progressive Party, Southern Sudanese Political Association (SSPA), Sudan African National Union (SANU), Sudan African People's Congress (SAPCO), Sudan National Party (SNP), Sudanese African Congress (SAC), Sudanese People's Federal Party (SPFP).